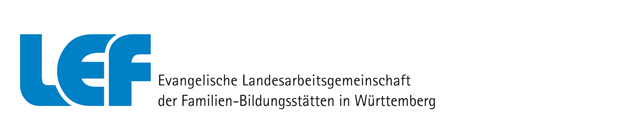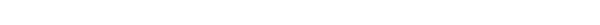| |
Liebe Mitglieder der LEF,
die Fußball-WM ist vorbei und wir starten wohl (fast) alle mit etwas Schlafdefizit in unsere LEF-Sommerklausur - aber das Bangen und Hoffen hat sich ja gelohnt und wir können am morgigen Dienstagabend in Bad Boll mit einem Gläschen Wein auf die deutsche Nationalelf anstoßen!
Ein kleines, aber feines Team hat die LEF-Klausur vorbereitet: Vielen Dank an Angelika von der Dellen (Köngen) und an Ilona Bohn (ehemals Brenneisen, Stuttgart) für ihren Einsatz! Die Anmeldezahlen sprechen für sich: wir haben um die 50 Anmeldungen für beide Tage! Es ist schön, dass so viele zusammenkommen. Wir wünschen uns eine atmosphärisch und inhaltlich gute Klausur!
Inhaltlich besonders hinweisen möchte ich noch auf die Information des Oberkirchenrats zum Urheberrecht auf den Homepages von Einrichtungen bzw. Kirchengemeinden im Kapitel „Sonstiges“. Bitte überprüfen Sie Ihre Homepages dementsprechend.
Folgende Kapitel finden Sie im Newsletter:
(1) LEF-Interna
(2) Fortbildungen, Tagungen und Veranstaltungen
(3) Kirche und Politik
(4) Projekte und Projektgelder
(5) Inklusion
(6) Statistik und Studien
(7) Literatur und Veröffentlichungen
(8) Sonstiges
(9) LEF-Termine im Überblick
(1) LEF-Interna
Aus der LEF-Geschäftsstelle:
Die LEF-Geschäftsstelle war mit der Vorbereitung der Sommerklausur beschäftigt, mit der Weiterentwicklung von LOC und der Planung von LEF-Fortbildungen für 2015.
Außerdem gab es eine Anhäufung von Terminen für den Geschäftsführer der LEF, wie z.B. die 2-tägige KiLag-Klausur, Sitzungen des Landesfamilienrates, der Fachgruppe Familie der DEAE und des Netzwerks Familie, EAEW-Vorstand, etc.:
Das gemeinsame Projekt der KILAG „Aufsuchende Weiterbildungsberatung“ (AWBB) ist gestartet. An drei Standorten (Karlsruhe, Waldshut-Tiengen, Reutlingen) in Baden-Württemberg werden in 2014 und 2015 neue Konzepte und Modelle ausprobiert, die sich mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Ansätzen der Aufsuchenden Beratungsarbeit an unterschiedliche Zielgruppen wendet. Dieses Projekt ist dem landesweiten Netzwerk zur Weiterbildungsberatung angegliedert. Und soll dieses um den Aspekt von aufsuchender Beratungsleistung ergänzen.
Eine sehr gute Nachricht, mit der Sie ab jetzt rechnen können:
Das Land BaWü hat die Förderung der Allg. Weiterbildung für die Jahre 2015/2016 um pro Jahr 20% erhöht und stellt somit weitere Mittel in Höhe von 8,6 Mill Euro zu Verfügung!
Die LEF plant und organisiert in Kooperation mit dem vhs Landesverband ein gemeinsames Projekt zur „Väterbildung“. Ein gemeinsames „Expertentreffen“ von Mitgliedern interessierten vhsen und fbsen ist für den 30.09. vormittags festgelegt. Hier sollen im kleinen Expertenrahmen (Vertretungen von ca. 3 fbsen und 3 vhsen) gemeinsam wichtige Aspekte, Themen und weitere Anliegen eingebracht und zusammengeführt werden. Diese stellen dann die Grundlage für die Konzeption des geplanten gemeinsamen Projektes. Projektstart soll mit einem öffentlichem Fachtag im Frühjahr 2015 sein.
Neuauflage des Landesprogramms STÄRKE am 1.7. gestartet
Mit geänderten Förderstrukturen – z.B. ohne die STÄRKE-Gutscheine - ist das Landesprogramm STÄRKE am 1.7. gestartet. Informationen über alle aktuellen Vorschriften, Abrechnungsformulare, Beantragungsformulare, etc. finden Sie auf der LOC-Plattform in der AG Stärke unter den Dokumenten. Vielen Dank an Ulrike Krusemark (HdF Sindelfingen) für die Ablage. Im Anhang an diesen Newsletter finden Sie das vom Sozialministerium veröffentlichte STÄRKE-Plakat.
www.evangelische-bildung-online-wue.de > LEF AG-Stärke > Gruppenpasswort: Staerke
Aus den Häusern:
HdF Stuttgart: die Hauptamtlich Pädagogische Mitarbeiterin Ilona Brenneisen heißt jetzt Ilona Bohn. Wir gratulieren ganz herzlich zu dieser schönen Nachricht!! Die neue Mailadresse lautet: bohn@hdf-stuttgart.de
(2) Fortbildungen, Tagungen und Veranstaltungen
Tagung zu „Kirche und Inklusion“: Wege in die (Kirchen-)Gemeinde für Menschen mit Behinderung
Wann? 24. bis 25. Juli 2014
Wo? Bad Urach
Veranstalter: Lebenshilfe, PTZ, Stift Urach
Zielgruppe: Fachtagung für Menschen mit und ohne Behinderung, Fachleute der Ambulanten und Offenen Hilfen, Pfarrerinnen und Pfarrer, Religionspädagoginnen und Religionspädagogen, Interessierte und Ehrenamtliche
Es werden verschiedene Workshops angeboten. Weitere Informationen siehe Ausschreibung im Anhang.
Abschlusstagung Gesellschaft gemeinsam gestalten - Junge Muslime als Partner
Wann? 24./25.09.2014
Wo? Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart
Das von der Robert Bosch Stiftung geförderte Projekt "Gesellschaft gemeinsam gestalten - Junge Muslime als Partner" der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart hat erstmals Strukturen, Schwerpunkte und Ausrichtung der Jugendarbeit in einem breiten Spektrum islamischer Vereinigungen untersucht. Darüber hinaus wurden deutschlandweit acht modellhafte Projekte identifiziert, in denen muslimische Jugendliche mit anderen Trägern zusammenarbeiten.
Aktivitäten junger Muslime gehören zu den spannendsten Entwicklungen im Bereich der ugendarbeit in Deutschland. Der Wunsch, an den Strukturen der Jugendhilfe teilzuhaben, ist Ausdruck dafür, dass junge Muslime sich als Teil der Gesellschaft sehen und ihre Zukunft mitgestalten wollen. In den Aktivitäten junger Muslime deutet sich auch an, wie sich der Islam in Deutschland in den nächsten Jahren entwickeln kann. Ausgehend von den Projektergebnissen geht es darum, wie sich Jugendarbeit angesichts wachsender Pluralisierung verändert. Welche Schritte interkultureller und interreligiöser Öffnung sind erforderlich? Wie können islamische Organisationen an den Strukturen der Jugendhilfe partizipieren? Wo gibt es Beispiele gelungener Kooperationen? Referenten sind u.a. Christoph Bochinger, Claudia Dantschke, Nora Gaupp (dji), Naika Foroutan, Birgit Jagusch, Michael Kiefer, Ministerin Bilkay Öney und Feridun Zaimoglu. Die Tagung bietet Austausch- und Vernetzungsmöglichkeiten unter Personen, die auf verschiedene Weise mit dem Thema "Junge Muslime als Partner" zu tun haben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Programm (s. Anhang). Sie können sich direkt online zu der Tagung anmelden: Anmeldung
Fachtag für Kommunen zum Thema "Raum für Kinderspiel!"
Wann? 8. Oktober 2014
Wo? Evangelische Hochschule Ludwigsburg
Veranstalter: FaFo
Inhalt: Ergebnisse der Studie des Deutschen Kinderhilfswerks „Raum für Kinderspiel!“ werden vorgestellt.
http://www.familienfreundliche-kommune.de/FFKom/Aktuelles/detail.asp?20140708.2.xml
Familienwirklichkeiten - neue Herausforderungen der Familien und Elternbildung
Wann? 8.-10.10.2014
Wo? Berlin
Veranstalter: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V., Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V
Anmeldung bis zum 11. August 2014
Die Kinder- und Jugendhilfe hat den Auftrag, positive Lebensbedingungen für Familien zu schaffen und ein gelingendes Aufwachsen zu ermöglichen. Präventive Angebote der Familienbildung und Erziehungsberatung nach § 16 SGB VIII fördern Familien durch die Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz und unterstützen sie bei der Bewältigung des komplexen Familienalltags. Sie richten sich dabei grundsätzlich an alle Familien. Um Familien zu erreichen, müssen Angebote lebensweltorientiert angeboten werden und auf die Bedarfe der Familien eingehen. Dabei entsprechen die Vielfalt von Familienformen und -modellen sowie der Unterschiedlichkeit von Lebensphasen und -situationen unterschiedliche Bedarfslagen. Wie diese Lebenswirklichkeit von Familien und sich daraus ergebende (neue) Herausforderungen im Bereich Familienbildung und Erziehungsberatung zeitgemäß abgebildet werden können und müssen, steht im Vordergrund der Fachveranstaltung. Es werden daher erfolgreiche Konzepte und neue Wege vorgestellt und erarbeitet, wie Familienbildung und Erziehungsberatung heute aufgestellt sein muss, um der Vielfalt von Familien und den gewandelten Bedarfen von Familien zu entsprechen und bedarfsgerechte Unterstützung anzubieten.
Die Veranstaltung möchte Schlaglichter auf die heutigen Lebenswelten von Familien werfen. Mit der neuen Vielfalt von Familienformen und Familienmodellen ergeben sich neue Bedarfslagen. Familienbildung und Erziehungsberatung brauchen neue lebensweltorientierte Konzepte, um Familien weiterhin zu erreichen. Wir wollen die Veranstaltung nutzen, um neue Wege der Familien- und Elternbildung gemeinsam zu erkunden und weiterzuentwickeln. Hierbei werden u.a. die Themen interkulturelle Öffnung, der Umgang mit neuen Medien und der Wandel der Paarbeziehung zwischen Eltern aufgegriffen.
Die Veranstaltung wendet sich an Leitungs- und Fachkräfte der Familienbildung, Erziehungsberatung und Kinder- und Jugendhilfe sowie von Familienbüros, Eltern-Kind-Zentren und Mehrgenerationenhäusern. Das Programm mit weiteren Informationen, das Workshopformular sowie zwei Anmeldeformulare (getrennte Anmeldung beim Deutschen Verein und der Tagungsstätte erforderlich) finden Sie unter http://www.deutscher-verein.de/03-events/2014/gruppe2/f-2225-14
Save the date: EAEW-Jahrestagung:
Lern-Lust als Frust-Schutz! Kreativ und aktiv den gesellschaftlichen Herausforderungen evangelischer Erwachsenen-, Familien- und Seniorenbildung begegnen
Wann? 21.10.2014, ganztags
Wo? Bad Boll
Einladung folgt noch.
Save the date: Fachvortrag "Resilienz - Kompetenz der Zukunft"
Wann? 7. November 2014:
Wo? Institut für Bildungsmangement Ludwigsburg
In der Reihe "Bildungsmanagement im Dialog" veranstaltet das Institut für Bildungsmanagement zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Bildungsmanagement e.V. einen weiteren Fachvortrag. Am Freitagabend, 7. November, wird Sylvia Wellensiek zum Thema "Resilienz - Kompetenz der Zukunft" referieren. Nähere Informationen folgen.
(3) Kirche und Politik
Sommertagung der Landessynode
Synode plädiert für mehr öffentlich geförderte Beschäftigung Langzeitarbeitsloser - gibt auch 2014 eine halbe Million Euro für erfolgreiches Beschäftigungsgutschein-Projekt.
Die Synodalen beschlossen den ersten Nachtragshaushalt für 2014 in Höhe von 32,2 Millionen Euro. Davon sind allein 11,5 Millionen Euro Clearing-Zahlungen an die EKD. Außerdem enthält er 500.000 Euro für das erfolgreiche Diakonieprojekt Beschäftigungsgutscheine für Langzeitarbeitslose. Ein weiterer großer Posten sind mit rund 5,5 Millionen Euro Baumaßnahmen, etwa für die anteilige Finanzierung des Neubaus einer Gemeinschaftsschule auf dem Gelände der evangelischen Schule am Firstwald in Mössingen oder Sanierungsarbeiten an der evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik Herbrechtingen. Zehn Millionen Euro werden für ein Projekt für einheitliche Pfarrplan-, Immobilien- und Strukturlösungen der Kirchengemeinden und Kirchenbezirke bereitgestellt, außerdem eine zusätzliche Pfarrstelle für Prädikanten-Ausbildung sowie verschiedene Maßnahmen zum Reformationsjubiläum finanziert.
Die Beauftragte für das Reformationsjubiläum 2017, Kirchenrätin Dr. Christiane Kohler-Weiß kündigte für das kommende Jahr einen Ideenwettbewerb zum Reformationsjubiläum 2017 an. Gute Ideen von der Basis sollten den Gedanken der Reformation in die Öffentlichkeit bringen. Schon in diesem Jahr wird neben anderen Veranstaltungen unter dem aktuellen Reformationsjahrtitel „Reformation und Politik“ ein politischer Stammtisch-Sonntag am 21. September 2014 stattfinden. Außerdem soll es 2016 einen Kirchengemeinderatstag in Fellbach geben. Rund 10 Millionen Euro werde die Landeskirche für Veranstaltungen bis und zum Reformationsjubiläum zur Verfügung stellen.
Lesen Sie mehr in der gesamten Pressemitteilung im Anhang und unter folgendem Links http://www.elk-wue.de/landeskirche/landessynode/sommertagung-2014/
http://www.elk-wue.de/landeskirche/landessynode/sommertagung-2014/freitag-4-juli-2014/
Forum Familienbildung der eaf – Nachfolge der bag
Bericht von der konstituierenden Sitzung
Am 24. Juni 2014 haben insgesamt 40 Vertreterinnen und Vertreter interessierter Einrichtungen und Arbeitsstellen an der konstituierenden Versammlung der Bundeskonferenz Evangelischer Familienbildungseinrichtungen teilgenommen, darunter 26 Mitglieder der ehemaligen BAG Evang. Familien-Bildungsstätten und Familien-Bildungswerke. In einer engagierten, teilweise kontroversen, aber immer auch konstruktiven Diskussion wurde eine Geschäftsordnung für das Forum Familienbildung als Arbeitsgrundlage für die nächsten zwei Jahre verabschiedet. Damit ist die Grundlage für eine kompetente und praxisorientierte Vertretung der Evangelischen Familienbildung auf Bundesebene gelegt. Schon auf der Fachtagung am Vortag hatten Frau Riemann-Hanewinckel für das Präsidium der eaf und Herr Paschold für das BMFSFJ ihre Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass mit dem Forum Familienbildung der langwierige Umstrukturierungsprozess erfolgreich abgeschlossen wird und die Evangelischen Familienbildungseinrichtungen unter dem Dach der eaf eine gute Heimat finden.
Im weiteren Verlauf der Bundeskonferenz wurde Frau Christine Peters von der Ev. Familienbildungsstätte Delmenhorst/Oldenburg-Land in Niedersachsen einstimmig zur Sprecherin gewählt. Zur Stellvertreterin wurde Frau Ute Lingner aus Berlin bestimmt. Außerdem wurden insgesamt acht Delegierte gewählt, die zukünftig die Bundeskonferenz in der Mitgliederversammlung der eaf vertreten. Die Servicestelle Familienbildung lädt nun alle interessierten Einrichtungen und Verbünde zur Mitarbeit im Forum Familienbildung ein und hofft auf zahlreiche Mitgliedsbekundungen. Denn je mehr Einrichtungen beim Forum mitmachen, umso stärker kann die Evangelische Familienbildung ihren Einfluss auf Bundesebene geltend machen. Weitere Informationen, z.B. über die Geschäftsordnung und den Mitgliedsbeitrag befinden sich auf der Homepage
Bundesprogramm: Finanzierung der Mehrgenerationenhäuser für 2015 gesichert
Mit der Veranschlagung von 16 Millionen Euro im Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2015 wird die Weiterförderung aller 450 Mehrgenerationenhäuser im gleichnamigen Aktionsprogramm des Bundes für 2015 gesichert. "Die Finanzierung für 2015 ist ein erster Schritt zu einer nachhaltigen Sicherung der Mehrgenerationenhäuser", sagt Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Manuela Schwesig. "Mein Ziel ist, die Häuser nachhaltig zu sichern und mit den Ländern und Kommunen eine gemeinsame Lösung für die dauerhafte Etablierung der Häuser zu finden. Mehrgenerationenhäuser stärken den Zusammenhalt in der Gesellschaft und helfen die Folgen des demografischen Wandels aktiv zu gestalten." Mehrgenerationenhäuser sind Begegnungsorte für Menschen aller Generationen. Mit den inhaltlichen Schwerpunkten Alter und Pflege, Integration und Bildung, Haushaltsnahe Dienstleistungen und Freiwilliges Engagement bieten die Häuser eine verlässliche Infrastruktur, die freiwilliges Engagement fördert und gesellschaftliche Teilhabe unterstützt. Insgesamt 450 Mehrgenerationenhäuser nehmen seit 01.01.2012 am laufenden Aktionsprogramm des Bundes teil. Jedes Haus erhält einen jährlichen Zuschuss von 40.000 Euro. Davon fließen bis Ende 2014 aus Bundesmitteln bzw. Geldern des Europäischen Sozialfonds (ESF) 30.000 Euro; die weiteren 10.000 Euro übernehmen Land oder Kommune. Informationen zum Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser II finden Sie unter www.mehrgenerationenhaeuser.de
Vorhabenplanung des BMFSFJ für das 2. Hj 2014 veröffentlicht
Der Themenkomplex „Wirtschaftliche Sicherung von Familien“ ist nur dürftig besetzt: Einzig das „Elterngeld Plus“ (das schon beschlossen ist) und die Gesamtevaluation der familienpolitischen Leistungen werden erwähnt. Die gesamte (sehr gut lesbare und übersichtliche) Präsentation von Manuela Schwesig finden Sie im Anhang.
Die Förderung von Festanstellungen in der Kindertagespflege wird fortgesetzt. Die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Manuela Schwesig, unterstützt auch weiterhin die Festanstellung in der Kindertagespflege. Die bisher geförderten Projekte haben maßgeblich dazu beigetragen, dass Träger zunehmend Tagesmütter und -väter fest anstellen und damit die Tagespflege quantitativ und qualitativ weiter ausbauen. Die Förderung der Personalausgaben wird ab dem 1. Juli 2014 bis zum 31. Dezember 2015 mit nochmals drei Millionen Euro fortgesetzt. Manuela Schwesig spricht sich dafür aus, dass die Kindertagespflege eine anerkannte und angemessen vergütete erzieherische Erwerbstätigkeit werden muss: "Eine gute Kinderbetreuung ist der Schlüssel, um Familien den Rücken zu stärken. Dabei spielt die Kindertagespflege als besonders flexible und familiennahe Betreuungsform eine zentrale Rolle. Wir müssen sie aber noch attraktiver machen und die Qualifizierung der Tagesmütter und -väter weiterentwickeln. Festanstellungsverhältnisse bieten Tagespflegepersonen mehr finanzielle Sicherheit und eine bessere soziale Absicherung im Krankheitsfall oder bei Urlaub. Und aus Sicht der Familien sind Festanstellungen auf Dauer verlässlicher." Die Förderung von Festanstellungen ist Teil des Aktionsprogramms Kindertagespflege, mit dem das Bundesfamilienministerium den qualitativen und quantitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung unterstützt. Die Kindertagespflege ist ein wichtiger Baustein bei der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung. Gleichzeitigt trägt der Ausbau der Kindertagesbetreuung zur gleichberechtigten Teilhabe beider Elternteile, insbesondere aber von Frauen, am Arbeitsmarkt bei.
Das Bundesprogramm gewährt Zuschüsse zu den Personalausgaben in Höhe von maximal 50 Prozent des Arbeitgeber-Brutto, wenn Tagespflegepersonen nach TVöD SuE mindestens nach Gruppe S 2 angestellt werden, die eine Mindestqualifizierung von 160 Unterrichtseinheiten nach dem DJI-Curriculum oder vergleichbaren Curricula und eine gültige Pflegeerlaubnis nachweisen. Der Anstellungsträger kooperiert mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, der das Modell zur Festanstellung von Kindertagespflegepersonen unterstützt und in die kommunale Jugendhilfeplanung integriert. Weitere Informationen finden Sie unter www.esf-regiestelle.eu und www.fruehe-chancen.de
1. Förderphase der Bundesinitiative Frühe Hilfen zu Ende – 2. Förderphase beginnt am 1. Juli 2014 - Bund stellt dafür 76,5 Millionen Euro zur Verfügung
Am 1. Juli 2014 beginnt die 2. Förderphase der Bundesinitiative Frühe Hilfen (01.07.2014 - 31.12.2015). Der Bund stellt für diesen Zeitraum 76,5 Millionen Euro für Frühe Hilfen zur Unterstützung von Familien zur Verfügung. In enger Zusammenarbeit mit den Ländern wurden die bereits bestehenden Angebote Frühe Hilfen weiterentwickelt und ausgebaut. "Die Bundesinitiative Frühe Hilfen hat bereits jetzt tragfähige Strukturen geschaffen. Das zeigen auch die Ergebnisse der Begleitforschung: In fast allen Jugendamtsbezirken wurden die strukturellen Voraussetzungen für einen bundesweiten flächendeckenden Ausbau von Netzwerken geschaffen. 92,5 Prozent der Befragten haben angegeben, dass in ihrem Jugendamtsbezirk eine Netzwerkstruktur für Frühe Hilfen bzw. Kinderschutz installiert ist. Zudem wurden für diese Netzwerke nahezu flächendeckend Koordinierungsstellen eingerichtet", erklärt Manuela Schwesig.
Diese Ergebnisse stammen aus der Begleitforschung, die das Nationale Zentrum Frühe Hilfen als Bundeskoordinierungsstelle übernommen hat. Die Ergebnisse zeigen jedoch auch: Zentrale Partner aus dem Gesundheitswesen wie Kinderärztinnen und -ärzte, niedergelassene Hebammen, Geburtskliniken und Kinderkliniken sind seltener in den lokalen Netzwerken anzutreffen, obwohl sie wichtige Partner in den Frühen Hilfen sind. Beim Einsatz von Familienhebammen und Fachkräften aus vergleichbaren Gesundheitsfachberufen besteht trotz der Ausweitung durch die Bundesinitiative weiterhin ein hoher Entwicklungsbedarf.
An diesen Aufgaben wollen wir in der 2. Halbzeit noch stärker als bisher arbeiten. Damit am Ende gilt: Frühe Hilfen werden Weltmeister - und die Familien haben gewonnen. Weitere Informationen unter www.fruehehilfen.de
Neues Gesetz hilft Schwangeren in Not
Am 1. Mai 2014 ist das Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt in Kraft getreten. Schwangere in Not haben damit die Möglichkeit, ihr Kind sicher - und auf Wunsch vertraulich - in einer Klinik oder bei einer Hebamme auf die Welt zu bringen. Das vom Bund eingerichtete anonyme Hilfetelefon "Schwangere in Not" bietet unter der Nummer 0800 40 40 020 kostenlose und qualifizierte Erstberatung. Es ist barrierefrei, mehrsprachig und vermittelt als 24-Stunden-Lotse rund um die Uhr an Beratungsstellen vor Ort. http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstellung,did=206466.html
Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig bringt ElterngeldPlus ins Kabinett
Unterstützungsleistung für Familien erster Schritt auf dem Weg zu einer Familienarbeitszeit
Das Bundeskabinett hat das Gesetz zur Einführung eines ElterngeldPlus mit Partnerschaftsbonus und einer flexibleren Elternzeit beschlossen. Arbeiten Mutter oder Vater nach der Geburt eines Kindes Teilzeit, können sie künftig länger Elterngeld beziehen. Neben dem Elterngeld wird mit dem Gesetz auch die Elternzeit flexibler. Die größere Flexibilität soll es Eltern besser ermöglichen, Auszeiten für ihr Kind und die Familie zu nehmen - und dann leichter beruflich wieder einzusteigen. Diese Neuregelungen sollen zum 1. Juli 2015 in Kraft treten.
Das bisherige Elterngeld wird bisher für maximal 14 Monate nach der Geburt des Kindes gezahlt. Steigen Mütter oder Väter schon währenddessen in Teilzeit beruflich wieder ein, verlieren sie damit einen Teil ihres Elterngeldanspruches. Das ändert sich mit dem ElterngeldPlus: Künftig ist es für Eltern die in Teilzeit arbeiten möglich, das ElterngeldPlus doppelt so lange zu erhalten. Ein Elterngeldmonat wird zu zwei ElterngeldPlus-Monaten. Damit lohnt sich für die Eltern nun auch der frühere Wiedereinstieg in den Job.
Ergänzend gibt es einen Partnerschaftsbonus: Teilen sich Vater und Mutter die Betreuung ihres Kindes und arbeiten parallel für mindestens vier Monate zwischen 25 und 30 Wochenstunden, erhalten sie jeweils zusätzlich für vier Monate ElterngeldPlus.
Alleinerziehende können das neue ElterngeldPlus im gleichen Maße nutzen.
Auch die Elternzeit wird deutlich flexibler. Wie bisher können Eltern bis zum 3. Geburtstag eines Kindes unbezahlte Auszeit vom Job nehmen. Künftig können 24 Monate statt bisher 12 zwischen dem 3. und dem 8. Geburtstag des Kindes genommen werden. Eine Zustimmung des Arbeitgebers wird dafür nicht mehr notwendig sein.
Für das Elterngeld bei Mehrlingsgeburten wird das Gesetz klargestellt. Es gelten wieder die Regelungen, die ursprünglich vom Gesetzgeber intendiert waren. Eltern von Mehrlingen haben einen Elterngeldanspruch und erhalten wie bisher den Mehrlingszuschlag in Höhe von 300 Euro. Diese Regelung soll zum 01.01.2015 in Kraft treten.
Für das Elterngeld stehen pro Jahr rund fünf Milliarden Euro zur Verfügung. Es beträgt mindestens 300 und höchstens 1.800 Euro im Monat. Liegt das Nettoeinkommen vor der Geburt des Kindes über 1.000 Euro, werden 65 bzw. 67 Prozent als Elterngeld gezahlt. Lag das Nettoeinkommen unter 1.000 Euro, ist das Elterngeld prozentual höher. Weitere Informationen finden Sie unter www.bmfsfj.de
(4) Projekte und Projektgelder
Neues aus der FaFo:
Landesprogramm „Gemeinsam sind wir bunt“ Förderung von Modellprojekten zum Bürgerengagement - Bewerbungsfrist 31.12.2014.
http://www.familienfreundliche-kommune.de/FFKom/Aktuelles/detail.asp?20140708.1.xml
Förderprogramm "Mittendrin - Willkommen im Engagement"
Bewerben Sie sich jetzt!
http://www.familienfreundliche-kommune.de/FFKom/Aktuelles/detail.asp?20140708.3.xml
(5) Inklusion
Lebenshilfe zum Bildungsbericht 2014: Eine Zwei-Klassen-Inklusion darf es nicht geben
Behinderte Menschen und die Inklusion nehmen einen Schwerpunkt im neuen Bildungsbericht für Deutschland ein. Es wird deutlich, dass auf dem Weg zu einer „Schule für Alle“ noch viele Steine aus dem Weg zu räumen sind. Am 24. Juni wird in Berlin das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung seinen Bericht mit Fachleuten der Behindertenhilfe diskutieren. Vertreten ist auch die Bundesvereinigung Lebenshilfe. Deutschlands größter Eltern- und Selbsthilfeverband für Menschen mit geistiger Behinderung begrüßt diesen Dialog. Die Lebenshilfe warnt aber auch vor einer Zwei-Klassen-Inklusion.
Auf Seite 198 des Bildungsberichts 2014 heißt es: „Alle Beteiligten stehen vor der Herausforderung, aus dieser bisherigen Struktur heraus ein System zu entwickeln, das der Verpflichtung zur Inklusion gerecht wird. Insbesondere im Schulbereich ist dabei zu klären, wo welche Schülerinnen und Schüler inkludiert werden und wo Sondereinrichtungen für temporären oder auch dauerhaften Besuch beibehalten werden sollen und wie bzw. in welchen Schritten diese Umsetzung erfolgen soll.“ Ulla Schmidt, Lebenshilfe-Bundesvorsitzende und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, hält diesen Ansatz für falsch: „Eine Zwei-Klassen-Inklusion darf es nicht geben. Inklusion muss ohne Wenn und Aber für alle Schüler mit Behinderung möglich sein, auch wenn sie geistig behindert sind oder einen hohen Unterstützungsbedarf haben.“ Jedes Kind – ob behindert oder nicht – soll die individuelle Förderung erhalten, die es braucht. Dazu müssten die Schulen barrierefrei gemacht und mit ausreichend qualifiziertem Personal ausgestattet werden. „Als Lehrerin weiß ich, wie wichtig es ist, die Unterrichtsstrukturen zu ändern: Individuelle Förderung muss das Grundprinzip des Unterrichtens in Deutschland werden, nur so kann Inklusion gelingen“, so Ulla Schmidt weiter. „Von diesem Ziel rücken wir als Lebenshilfe keinen Millimeter ab.“ Bis es erreicht ist, müssten die Eltern aber unbedingt ein Wahlrecht zwischen Regel- und Förderschule behalten.
Quelle: Pressemitteilung der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. vom 23.6.2014
(6) Statistik und Studien
Studie „Kitas als Brückenbauer. Interkulturelle Elternbildung in der Einwanderungsgesellschaft“ des SVR-Forschungsbereichs.
Der SVR-Forschungsbereich hat in der Studie eine Bestandsaufnahme vorgenommen und überprüft, inwieweit in den Kindertageseinrichtungen in Deutschland bereits die notwendigen Organisationsstrukturen bestehen, um Elternbildungsangebote interkulturell zu öffnen. Für die Studie, die in Zusammenarbeit mit der Vodafone Stiftung Deutschland entstanden ist, wurden Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) ausgewertet.
Laut SVR-Forschungsbereich geht aus der Studie Folgendes hervor: die meisten Kitas in Deutschland haben sich auf den Weg gemacht, ihre Angebote interkulturell zu öffnen. Doch nur wenige Einrichtungen erfüllen tatsächlich die zentralen Rahmenbedingungen für eine interkulturelle Öffnung der Elternbildung – und bieten somit die Chance, dass Familien unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem kulturellen Hintergrund oder ihrer sozioökonomischen Lage davon profitieren können.
Der Forschungsbereich beim Sachverständigenrat führt eigenständige, anwendungsorientierte Forschungsprojekte zu den Themenbereichen Integration und Migration durch. Die projektbasierten Studien widmen sich neu aufkommenden Entwicklungen und Fragestellungen. Ein Schwerpunkt der Forschungsvorhaben liegt auf dem Themenfeld Bildung. Der SVR-Forschungsbereich ergänzt die Arbeit des Sachverständigenrats. Die Grundfinanzierung wird von der Stiftung Mercator getragen.
Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration geht auf eine Initiative der Stiftung Mercator und der VolkswagenStiftung zurück. Ihr gehören weitere sechs Stiftungen an: Bertelsmann Stiftung, Freudenberg Stiftung, Gemeinnützige Hertie-Stiftung, Körber-Stiftung, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und Vodafone Stiftung Deutschland. Der Sachverständigenrat ist ein unabhängiges und gemeinnütziges Beobachtungs-, Bewertungs- und Beratungsgremium, das zu integrations- und migrationspolitischen Themen Stellung bezieht und handlungsorientierte Politikberatung anbietet.
Die Studie sowie eine Infografik können Sie hier herunterladen: www.svr-migration.de/Forschungsbereich. Die gesamte Studie finden Sie auch als pdf im Anhang.
Wo steht Ihre Gemeinde, Ihr Kreis und Ihre Region im Vergleich zu anderen?
"Die Region im Blick" - eine neue Veröffentlichung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg macht die Standortbestimmung möglich. Mit der ersten Auflage der Reihe »Die Region im Blick« stellt das Statistische Landesamt eine auf den Vergleich ausgerichtete Publikation vor. Thematisch aufbereitete Indikatoren machen das spezifische Profil einer jeden Region innerhalb der Landesgrenzen Baden-Württembergs sichtbar und ermöglichen den Vergleich von Gemeinden, Kreisen und der jeweiligen Region mit anderen und dem Landesdurchschnitt. Die 64-seitige Broschüre ist thematisch breit gefächert. Indikatoren zur Entwicklung und Zusammensetzung der Bevölkerung, zu Bildung und Betreuung, den Öffentlichen Finanzen und sozialen Sicherungssystemen, Arbeitsmarkt, Wirtschaftsstruktur und Umwelt werden darin angeboten. Die Daten sind so aufbereitet, dass ein regionaler Vergleich und die Identifizierung räumlicher Zusammenhänge schnell möglich sind. Insbesondere die Darstellung mittels Karten macht die Einordnung leicht. Ergänzend werden die Werte in Tabellen präsentiert. Kurze und verständliche Erläuterungen beschreiben die Indikatorberechnung und weisen auf statistische Besonderheiten hin. Das Datenmaterial ist noch durch eine thematisch sortierte Linkliste ergänzt, die direkten Zugang zu vielfältigen weiterführenden Informationen aus dem Angebot des Statistischen Landesamtes und anderen statistischen Quellen bietet.
Weitere Informationen und Bestellung unter http://www.statistik-bw.de/Pressemitt/2014222.asp
(7) Literatur und Veröffentlichungen
Expertise "Gesundheitsfördernde Elternkompetenzen"
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) veröffentlicht die Ergebnisse einer zweiteiligen Expertise zu wissenschaftlichen Grundlagen und evaluierten Programmen für die Förderung elterlicher Kompetenzen bei Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren. Link zur Expertise
Curriculum: Gesund aufwachsen in der Kita. Zusammenarbeit mit Eltern stärken
Mit dem Curriculum zur Qualifizierung von Kita-Fachkräften für die Zusammenarbeit mit Eltern in Themen der Gesundheitsförderung, möchte die BZgA didaktische und methodische Anregungen zur (Weiter-)Qualifizierung frühpädagogischer Fachkräfte an die Hand geben. Das Curriculum ist zentrales Ergebnis eines Kooperationsprojekts der BZgA.
Im Rahmen der Strategie der Bundesregierung zur Förderung der Kindergesundheit führte die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) gemeinsam mit den Kooperationspartnern Zentrum für Kinder- und Jugendforschung an der Evangelischen Hochschule Freiburg (ZfKJ), Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen (LVG und AFS) und Hochschule Neubrandenburg (Fachbereich Soziale Arbeit, Bildung und Erziehung; Vorschulpädagogik) bis Ende 2011 das Projekt "Gesund aufwachsen in der Kita. Zusammenarbeit mit Eltern stärken" durch.
Zentrales Ergebnis dieses Modellprojekts ist das "Curriculum zur Qualifizierung der Fachkräfte-Teams in Kindertageseinrichtungen für die Zusammenarbeit mit Eltern in der Gesundheitsförderung". Es wurde in Zusammenarbeit der BZgA mit den Kooperationspartnern entwickelt und nach den Grundprinzipien der partizipativen Qualitätsentwicklung gemeinsam mit den Fachkräfte-Teams von neun Kindertageseinrichtungen erprobt und anschließend zur jetzigen Form modifiziert. Das 76-seitige Fachkräfte-Curriculum kann hier heruntergeladen werden. Es soll Trägerverbänden von Kindertageseinrichtungen wie auch Anbietern in der Aus-, Fort- und Weiterbildung didaktische und methodische Anregungen zur (Weiter-) Qualifizierung frühpädagogischer Fachkräfte zu Themen der Gesundheitsförderung an die Hand geben. Link zum Curriculum
Monitor Familienforschung Nr. 33 / Mehr Zeit für Familien - kommunale Familienzeitpolitik in Deutschland
Manuela Schwesig: „Die Lebenswirklichkeit von Familien hat sich verändert. Das alte Modell, nach dem der Mann das Geld nach Hause bringt und sich die Frau um Haus und Kinder kümmert und etwas dazuverdient, entspricht schon lange nicht mehr den Wünschen der heutigen Eltern. Am liebsten hätten Mütter wie Väter gern beides, Familie und Beruf. Familien geht es um eine gute Balance im Leben, und sie wünschen sich ein partnerschaftliches Miteinander. 60 Prozent der Paare mit kleinen Kindern halten partnerschaftliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf für das ideale Lebensmodell. Allerdings gelingt es nur 14 Prozent der Eltern, diesen Wunsch auch umzusetzen. Dieses Missverhältnis zwischen Wunsch und Wirklichkeit, das zu großer Unzufriedenheit führt, müssen wir gemeinsam überwinden.
Zeit ist dabei eine Schlüsselressource. Eltern brauchen und wollen mehr Zeit für die Familie. Ziel einer modernen Familienpolitik ist es, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, damit Familien mehr Flexibilität in der Gestaltung ihres Familienlebens haben. Ich will eine Politik, die die Partnerschaftlichkeit innerhalb der Familie fördert. Dazu gehört in erster Linie eine familienfreundliche Arbeitswelt. Aber auch in den Kommunen müssen Politik und Wirtschaft umdenken und Lösungen finden, damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelingt und Eltern nicht in Zeitkonflikte geraten. Kommunen können gewinnen, wenn sie die Gestaltung der zeitlichen Rahmenbedingungen von Familien zu ihrer Aufgabe machen. Kommunale Familienzeitpolitik ist dafür eine Erfolg versprechende Strategie.
Der vorliegende Monitor rückt kommunale Familienzeitpolitik als politisches Handlungsfeld in den Mittelpunkt und gibt einen Überblick über die bisherigen zeitpolitischen Maßnahmen. Dabei wird anhand von Beispielen gezeigt, wie Kommunen eine Zeitpolitik für Familien vor Ort umsetzen, welche Kosten dabei entstehen und was damit zu gewinnen ist.“ http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Monitor-Familienforschung-Ausgabe-33,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
Ernährungskommission der DGKJ aktualisiert Empfehlungen für das Säuglingsalter
Zahlreiche aktuelle Studien und Publikationen hat die Ernährungskommission der Deutschen Fachgesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) ausgewertet und in ihre Empfehlungen für die Ernährung gesunder Säuglinge einbezogen. Dabei wurden auch neue Trends in der Babykost kritisch betrachtet. Z. B. Baby-led Weaning – Selbstfütterung des Babys.
Selbstfütterung statt Babybrei – das ist das Ziel des sog. „Baby-led Weaning“ (weaning = Abstillen). Hier nimmt sich das Baby seine Beikost selbst, indem es die angebotene Nahrung selbständig zum Mund führt und sich daran versucht. Nun wird auch bei konventionellerem Zugang ein Säugling nach einigen Monaten dazu ermuntert, mal an einem Stück Obst zu lutschen, doch sehen die Experten die Methode des Baby-led Weaning als grundsätzlich problematisch an: Bei konsequenter Einhaltung der ausschließlichen Selbstfütterung und dem durchgängigen Verzicht auf Brei wird, bestimmt durch die notwendigen motorischen Entwicklungsfortschritte des Kindes, der Beginn der Beikostgabe in den Lauf des 2. Lebenshalbjahres verschoben. Zu spät, um die Chancen auf ein gemindertes Allergie- und Zöliakierisiko nutzen zu können. Denn, so belegen es Studien seit längerem, die Einführung von Beikost nach der 17. und vo r der 26 . Lebenswoche (5.-7. Lebensmonat) mindert diese Risiken wesentlich. Zudem betont die DGKJ-Ernährungskommission, dass bei dieser Methode die angemessene Versorgung mit kritischen Nährstoffen wie Eisen nicht gesichert ist. Z. B. Vegetarisch bis vegan – auch für´s Baby? Immer mehr Erwachsene ernähren sich vegetarisch oder vegan und wollen dies, wenn sie Eltern werden, auch überzeugt an ihre Kinder weitergeben. Die DGKJ-Ernährungsexperten kommen in ihrer Empfehlung zu dem Schluss, dass eine ovo-laktovegetarische Ernährung im 1. Lebensjahr möglich ist, dann aber eine sorgfältige Auswahl der Lebensmittel und den Blick auf die Eisenversorgung des Kindes voraussetzt. Eine vegane Ernährung hingegen – rein pflanzlich, keine Milch, kein Ei - verursacht schwerwiegende Defizite in der Nährstoffversorgung des Kindes und ist mit hohen Risiken für seine Entwicklung und Gesundheit verbunden, bis hin zu irreversiblen neurologischen Schäden.
Insgesamt bestätigt die Ernährungskommission in ihrer wissenschaftlichen Publikation die Empfehlung, Säuglinge in den ersten 4 bis 6 Lebensmonaten ausschließlich zu stillen (auch kürzere Stillzeiten bzw. teilweises Stillen sind sinnvoll!) und eine stufenweise Einführung von Beikost bis hin zur normalen Familienkost zum Ende des 1. Lebensjahres. Die gesamten Empfehlungen zur „Ernährung gesunder Säuglinge“ sind – samt eines Ernährungsplans für das Babyalter – einzusehen unter http://www.dgkj.de/uploads/media/1406_EK_Empfehlungen_Erna%CC%88hrunggesunder_Sa%CC%88uglinge.pdf
Quelle: Pressemitteilung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. vom 17.6.2014
Sexualpädagogik: neue Ausgabe „frühe Kindheit“ erschienen
Zu dem Themenschwerpunkt „Sexualpädagogik“ ist die neue Ausgabe der Zeitschrift „frühe Kindheit“ erschienen. Das Heft enthält Beiträge u. a. von Bettina Schuhrke („Die psychosexuelle Entwicklung in der frühen Kindheit“), Anja Henningsen und Mirja Beck („Sexuelle Bildung und ihr gewaltpräventiver Charakter in der Kindertagesstätte“), Stefan Timmermanns („Sexualfreundliche Erziehung in Kitas. Definitionen und Argumente“), Anna Buschmeyer („Männer in Kitas: Zwischen Rollenvorbild und Generalverdacht“), Beate Martin („Sexuelle Bildung benötigt einen „roten Faden“. Gedanken zur Umsetzung eines sexualpädagogisches Konzepts in Einrichtungen der Vorschulerziehung“), Stefanie Amann („Trau dich! Bundesweite Initiative zur Prävention des sexuellen Kindesmissbrauchs“), Johannes-Wilhelm Rörig („‘Wir sind eine Kita un d haben mit dem Thema nichts zu tun!‘ Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt sind wichtig. Die Kampagne ‚Kein Raum für Missbrauch‘ ermutigt Eltern und Fachkräfte, sich für Prävention in Einrichtungen stark zu machen“) sowie ein Interview mit Uwe Sielert, Professor für Pädagogik am Institut für Pädagogik der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel („Sexualität müsste nicht nur als Konsumgut, sondern vor allem als Bildungsgut ernster genommen werden“).
Außerdem enthält das Heft folgende Praxisbeiträge: Sonja Blattmann und Karin Derks („Eines sag ich dir: Mein Körper gehört mir! Spielerische Alltagsprävention und Sexualerziehung im Kindergarten“), Anja Henningsen („Zur Ausbildungssituation an den (Fach-)Hochschulen im Themenbereich Sexualpädagogik, sexuelle Bildung und Schutz vor Missbrauch“), „Das Institut für Sexualpädagogik (isp) Ziele, Aufgaben und Angebote für den Vorschulbereich“.
Das Heft kann bei der Geschäftsstelle der Deutschen Liga für das Kind zum Preis von 6,- Euro (zzgl. Versandkosten) bestellt werden. Tel.: 030-28 59 99 70, Fax: 030-28 59 99 71, E-Mail: post@liga-kind.de, www.fruehe-kindheit-online.de
Infodienst Bundesinitiative Frühe Hilfen aktuell 1/2014
Die Bundesinitiative Frühe Hilfen versendet kostenlos einen Newsletter: Der aktuelle Infodienst bringt ein Interview mit Prof. Dr. Jörg Fischer und Prof. Dr. Raimund Geene zum Thema Netzwerkkoordination. Die Rubriken „Impulse“ und „Info kompakt“ bieten ganz konkrete Unterstützung für die Akteurinnen und Akteure der Frühen Hilfen u.a. mit Hinweisen auf Austauschmöglichkeiten, gelungene Praxisbeispiele, Neuerscheinungen und Termine. Über ein Online-Bestellformular können die aktuelle und alle weiteren Ausgaben des viermal jährlich erscheinenden Informationsdienstes kostenfrei abonniert werden: http://www.fruehehilfen.de/bundesinitiative-fruehe-hilfen/infodienst/ausgabe-01-2014/
Hilfe und Unterstützung in der Schwangerschaft - Bundesstiftung Mutter und Kind
Der Flyer informiert über die finanziellen Hilfen der Bundesstiftung Mutter und Kind für schwangere Frauen in einer Notlage sowie die Voraussetzungen und Antragsmodalitäten. Zusätzlich wird auf die verschiedenen gesetzlichen Leistungen hingewiesen und es werden weitere Hilfen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend rund um Schwangerschaft, Geburt und das Leben mit Kindern kurz vorgestellt. zum Flyer hier
DJI Impulse 1/2014
Zentrales Thema der Ausgabe 1/2014 sind junge Flüchtlinge in Deutschland. Die Problematik wird in mehreren Artikeln unter sehr verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Zum einen geht es allgemein um Deutschland als Einwanderungsland. Zum anderen wird die besondere Situation der Kinder fokussiert, beispielsweise als Kinder zweiter Klasse oder Adressaten von Kinderschutz und Jugendhilfe. Im Interview erläutert die Bundestagsvizepräsidentin ihre Forderung, auf europäischer Ebene umzudenken. Das Dossier stellt den aktuellen Forschungsstand vor. Andere Artikel widmen sich unter anderem der Sprache als Integrationsfaktor und der Menschenrechte von Flüchtlingen.
Zum Heft hier
Salooja, Ravinder (2014): Leiten und Führen in der Kirche. Zum Management von Freiwilligkeit
Uelvesbüll: Der Andere Verlag.
Kirchliches Leben ist ohne ehrenamtliches Engagement nicht vorstellbar. In den vergangenen Jahren sind Versuche durchgeführt worden, mit einem förmlichen Freiwilligen-Management auf die veränderte Situation ehrenamtlichen Engagements zu reagieren. Ravinder Salooja ist in seiner (jetzt publizierten) Masterarbeit der Frage nachgegangen, wie sich das Verständnis von Leiten und Führen in diesem Kontext innerhalb der Kirche verändert. Deutlich wird, dass Kirchenleitung vor allem als Management von Freiwilligkeit zu verstehen ist.
(8) Sonstiges
Informationen zum Urheberrecht auf Homepages, etc.
Der Evang. Oberkirchenrat hat eine Warnung vor Abmahnungen aufgrund von Urheberrechtsverletzungen durch Internetauftritte an alle Pfarrämter und Kirchengemeinden herausgegeben:
„(…) Zunehmend spezialisieren sich Rechtanwaltskanzleien auf die Abmahnung von Urheberrechtsverstößen und suchen systematisch nach Rechtsverletzungen. Die erheblichen Kosten einer Abmahnung (Schadenersatz, Rechtsanwaltskosten, etc.) sind in der Regel vom Abgemahnten (also z. B. der Kirchengemeinde) zu tragen. Dies nehmen wir zum Anlass, an die typischen Fallstricke kirchlicher Internetauftritte zu erinnern - verbunden mit dem Hinweis, dass sämtliche Internetseiten regelmäßig auf mögliche Urheberrechtsverletzungen überprüft werden sollen. Es ist grundsätzlich verboten, auf Internetseiten oder in sonstigen Publikationen (z. B. im Gemeindebrief) ohne die Zustimmung des Rechteinhabers urheberechtlich geschützte Werke wie Texte, Gedichte, Bilder, Fotografien, Skizzen oder Kartenausschnitte, Muster etc. zu veröffentlichen, deren Urheber in der Regel nicht länger als 70 Jahre verstorben ist. Sofern die Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken für die Darstellung der Internetseite unabdingbar ist, ist mit den Rechteinhabern direkt über die Lizenz zu verhandeln und ein Vertrag zu schließen. Auch die Darstellung von Kartenmaterial (z. B. in Anfahrtsbeschreibungen) ist grundsätzlich urheberrechtlich geschützt und darf nur nach dem Erwerb einer entsprechenden Lizenz wiedergegeben werden. Dies gilt namentlich für eingescannte oder von Internetseiten herunter geladene Kartenausschnitte oder Bilder, Filme einschließlich sog. animierter Grafiken (GIFDateien) etc. Bei der Prüfung Ihres Internetauftritts achten Sie bitte besonders auf die Wiedergabe von Anfahrt-Skizzen, Fotos, Texten und Zitaten. Prüfen Sie nicht nur Ihre aktuellen Seiten, sondern auch Ihre Archive wie z. B. Sammlungen von Gemeindebriefen in digitalisierter Form. Löschen Sie Dateien, die Sie nicht mehr benötigen. Verwenden Sie ausschließlich Text- und Fotomaterial, deren Urheberrechte Sie selbst geprüft bzw. erworben haben. Sollten Sie z. B. Fotos oder Texte entdecken, die von anderen Internetseiten kopiert und übernommen wurden, deren Urheberrechte aber nicht ausdrücklich von Ihnen geprüft wurde, löschen Sie im Zweifel die Wiedergabe! Beachten Sie beim Löschen von Dateien und vor allem von Fotos, dass nicht nur das Foto selbst, sondern sämtliche Links und sonstigen Zugänge, sowie ggf. separat abgelegte Bild-Dateien gelöscht werden müssen, um jeglichen Zugriff zu verhindern. Prüfen Sie danach alle Möglichkeiten, die Datei wieder zu finden.
Checkliste zur Vermeidung typischer Fallstricke kirchlicher Internetauftritte:
1. Fotos
- Werden Fotos auf den Internetseiten wiedergegeben?
- Urheber der Bilder?
- Bei eigenen Fotos und erkennbarer Darstellung von Personen: Liegt die Einwilligung der abgebildeten Personen vor?
- Bei fremden Fotos (z.B. aus dem Internet): Rechte klären! Lizenzgebühren erfragen und ggf. bezahlen oder Fotos herunternehmen
- Korrekte Darstellung der geschützten Rechte (Lizenzregelungen beachtet z. B. bei Fotos von Wikipedia Urhebernotiz auf dem Foto)
- Bereits erworbene Lizenzrechte genau prüfen: Lizenzen, die den Abdruck im Printmedium umfassen gelten oftmals nicht für die Veröffentlichung des gesamten Gemeindebriefs im Internet
2. Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst
- Werden Texte, Gedichte o.ä. geschützte Werke wiedergegeben?
- Abgrenzung zwischen (zulässigem) Zitat gemäß § 51 UrheberRG und lizenzpflichtigem Text
- Bei Texten: Urheberschaft prüfen und Rechteinhaber klären
- Lizenzgebühr erfragen und ggf. bezahlen, oder Text löschen.
- Umfang von bereits erworbenen Lizenzrechten genau prüfen, umfasst die Lizenz die Veröffentlichung im Internet, oder Beschränkung auf den Abdruck im Printmedium?
3. Anfahrtsskizzen und Kartenausschnitte
- Werden Anfahrtsskizzen und Karten auf den Internetseiten wiedergegeben?
- Urheber oder Rechteinhaber klären
- Lizenzgebühren erfragen und ggf. bezahlen oder die Karte/Skizze herunternehmen...
Sofern eine Kirchengemeinde einen Kartenausschnitt als Anfahrtsskizze auf ihrer Internetseite veröffentlichen möchte, stellen die zuständigen Vermessungsämter Kartenausschnitte unentgeltlich zur Verfügung
Kinderchirurgen warnen vor Sturz vom Wickeltisch
80 Prozent aller Verletzungen von Kindern unter zwei Jahren finden im häuslichen Umfeld statt. Stürze vom Wickeltisch stehen dabei an erster Stelle der Unfallursachen, wie eine Auswertung des Statistischen Bundesamts aus dem Jahr 2013 zeigt. Stürze aus dieser Höhe können bei Säuglingen und Kleinkindern zu schweren Verletzungen, insbesondere zu schweren Kopfverletzungen, führen. Diese Unfälle sind jedoch vermeidbar. Die Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie (DGKCH) nimmt deshalb den Kindersicherheitstag am 10. Juni 2014 zum Anlass, auf die Gefahren hinzuweisen und junge Eltern aufzuklären, wie sie ihren Nachwuchs schützen können.
Es passiert oft ganz schnell: Ein unbedachter Moment und schon hat sich das Baby zur Seite gerollt und ist vom Wickeltisch gestürzt. Lebensbedrohliche Schädel-Hirn-Traumen (SHT) können die Folge sein: „Weil der Kopf kleiner Kinder relativ groß und schwer ist im Vergleich zu den anderen Körperteilen, trifft er meist als Erstes auf“, sagt DGKCH- Pressesprecher Dr. med. Tobias Schuster, Chefarzt der Kinderchirurgie am Klinikum Augsburg. Was die Stürze außerdem so gefährlich macht: In diesem Alter sind zum einen die Schutzreflexe noch schwach ausgebildet, zum anderen lässt sich die noch nicht stabil verknöcherte, dünne Schädeldecke leicht eindrücken. Außerdem reißen die noch zarten Blutgefäße im Bereich der Hirnhäute bei heftigen Stößen leicht ein und können dadurch bedrohliche Blutungen im Kopf verursachen.
Zwar stufen Ärzte mehr als 90 Prozent der Schädel-Hirn-Traumen mit der Diagnose „Gehirnerschütterung“ bei Kindern als leicht ein. Doch nicht immer lässt sich die Schwere der Verletzung sofort beurteilen. „Deshalb ist in jedem Fall eine sorgfältige Beobachtung über 24 bis 48 Stunden nach dem Vorfall angezeigt. Erscheint der Sturz harmlos und geht es dem Kind gut, genügt zunächst die Überwachung zu Hause durch die Eltern. War der Unfall eher schwer, zeigen sich eindeutige Verletzungen oder erscheint das Kind in seinem Verhalten verändert, sollte es unmittelbar ins Krankenhaus aufgenommen werden“, so der Kinderchirurg. Denn eine Blutung im Schädelinneren könne sich noch Stunden bis Tage nach dem Unfall bemerkbar machen. Zu den Symptomen gehören Erbrechen, Krampfanfälle, ein verändertes Wesen, Lust- und Appetitlosigkeit, Schläfrigkeit oder Kopfschmerzen. „Die beiden Pupillen sollten bei gesunden Kindern normalerweise gleich groß sein und kleiner werden, wenn Licht darauf scheint. Ist dies nicht der Fall, ist das ein Alarmzeichen“, sagt Schuster.
Sind Eltern im Zweifel, sollten sie ihr Kind umgehend einem Kinderchirurgen oder Kinderarzt vorstellen. Auch wenn es gilt, in diesen Fällen keine Zeit zu verlieren, sollte immer darauf geachtet werden, unnötige, das Kind zusätzlich belastende Untersuchungen und Maßnahmen zu vermeiden. „Zur Ersteinschätzung kommt heute bevorzugt eine Ultraschalluntersuchung zum Einsatz“, sagt Schuster. Ein qualifizierter Kinderradiologe kann damit meist die Frage nach einem Schädelbruch schonend – und ohne die Strahlenbelastung durch das Röntgen oder die Computertomografie – abklären. Besonders bei Säuglingen sei auch der Ausschluss einer Hirnblutung per Ultraschall möglich.
Doch Vorbeugen sei hier die beste Therapie: „Kinder entwickeln sich sprunghaft und können sich von einem Tag auf den anderen plötzlich drehen, das ist Eltern oft nicht bewusst“; so Schuster. Eltern sollten immer eine Hand am Kind haben, wenn es auf dem Wickeltisch liegt. Damit der Nachwuchs nicht herunterfallen kann, sind zudem hohe Seitenwände am Wickeltisch vorteilhaft. Und auf der sicheren Seite ist, wer unruhige, eingecremte oder nasse Kinder gleich auf dem Bett oder dem Boden wickelt.
Quelle: Pressemitteilung der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie vom 6.6.2014
Kinderchirurgen: Jungen mit Hodenhochstand schon im ersten Lebensjahr behandeln
Jungen mit Hodenhochstand sollten schon bis zum Ende des ersten Lebensjahres behandelt werden. Zu dieser Empfehlung kommt die neue Leitlinie Hodenhochstand, die unter Federführung der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie (DGKCH) entstanden ist. Die Fachgesellschaft spricht sich hierin ausdrücklich gegen die bisher häufig angewandte Praxis aus, mit der Behandlung länger abzuwarten. Dies könne eine verminderte Fruchtbarkeit bis hin zu Sterilität zur Folge haben, warnen die Experten. Zudem sinke durch eine frühzeitige Therapie das Risiko, später an Hodenkrebs zu erkranken.Beim Hodenhochstand befindet sich der Hoden bei der Geburt nicht im Hodensack, sondern noch im Bauch oder den Leisten. Er ist die häufigste Anomalie des männlichen Urogenitaltrakts: Bis zu drei Prozent der „reif“ geborenen Jungen kommen mit dieser Abweichung zur Welt, bei männlichen Frühgeborenen sind es sogar bis zu 30 Prozent.
Da der Hodenhochstand keine Beschwerden verursacht und die Keimdrüse bei etwa sieben Prozent der betroffenen Babys in den ersten sechs Lebensmonaten von allein an den richtigen Platz wandert, sind sich Ärzte darüber einig, dass diese Zeit erst einmal abzuwarten ist. „Aber anders als früher, wo man eine Operation oft erst nach Jahren durchgeführt hat, ist man heute der Auffassung, dass der Hoden bis zum ersten Geburtstag in den Hodensack verlagert werden sollte“, sagt Privatdozentin Dr. Barbara Ludwikowski, Chefärztin der Klinik für Kinderchirurgie auf der Bult, Hannover. Denn Untersuchungen zeigen, dass sich die Zahl der Samenvorläuferzellen beim Hodenhochstand ab dem Ende des ersten Lebensjahrs laufend verringert. Da diese spermienbildenden Zellen unwiederbringlich verloren gehen, ist die Fruchtbarkeit danach immer schwerer zu erhalten. (…)Der Hochstand wird in der Regel „offen“ operiert. Bei Verdacht auf den sogenannten Bauchhoden kommt jedoch immer die Schlüssellochtechnik zum Einsatz. Die Erfolgsraten der Operationen liegen bei 74 bis 96 Prozent. Vor der OP-Planung besteht zudem die Möglichkeit, die Kinder durch eine Hormontherapie zu behandeln. „Die Gabe von Hormonen ist jedoch umstritten, da die langfristigen Folgen einer Einwirkung auf den kindlichen Hormonhaushalt noch nicht abschließend geklärt sind“, gibt Dr. Ludwikowski zu bedenken. Zudem sei die Erfolgsquote mit rund 20 Prozent niedrig, die Rückfallquote aber hoch. „In vielen skandinavischen Ländern wird die Hormontherapie ausdrücklich nicht empfohlen“, ergänzt Chefarzt Dr. Tobias Schuster, Pressesprecher der DGKCH.
„Unser Ziel ist, die Behandlung bis zur Vollendung des 12. Lebensmonats abzuschließen, dann erhalten wir die besten Ergebnisse“, fasst DGKCH-Präsident Professor Bernd Tillig zusammen. „Voraussetzung ist jedoch, dass Eltern ihre kleinen Jungen bei Verdacht auf Hodenhochstand frühzeitig einem Kinderchirurgen zur Abklärung vorstellen. Dann können wir auch das optimale Zeitfenster zur Therapie nutzen.“ Hier müsse noch Aufklärungsarbeit geleistet werden.
Quelle: Pressemitteilung der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie vom 2.6.2014
Lehrfilme zur Elternbildung aus der Schweiz – für Kursleitungen im Eltern-Kind-Bereich!
www.kinder-4.ch
Die 40 Filme sind gut sortiert nach Themen und nach Alter, sie betreffen die Entwicklung von 1.-4. Lebensjahr, es gibt auch Broschüren dazu. Einfach mal reinklicken!
Interessante Homepage: www.familienplanung.de
Hier findet man viele wissenschaftlich fundierte Informationen rund um Schwangerschaft und Geburt, u.a. gibt es auch ein Interview mit Sven Hildebrandt, ärztlicher Leiter des Dresdner Geburtshauses, zum Thema „Männer und Geburt“: Worauf sollten Männer sich bei einer Geburt vorbereiten? Was können Männer tun, wenn ihnen danach kritische Momente der Geburt immer wieder durch den Kopf gehen? Woran kann ein Mann erkennen, dass ihn das Geburtserlebnis über Gebühr belastet? Dieses Interview lesen Sie unter http://www.familienplanung.de/schwangerschaft/vater-werden/ich-werde-vater/interview-geburt-ist-ein-archaisches-erlebnis/
(9) LEF-Termine im Überblick
15.-16.07.2014: LEF-Sommerklausur in Bad Boll
21.07.2014, 17-19 Uhr: Teamsitzung Eltern-Kind-Qualifizierung
27.09.2014, 9-18 Uhr: LEFino-Qualifizierung, Baustein 6
27.09.2014, 9-16 Uhr: Eltern-Kind-Qualifizierung, Baustein 1. Bitte noch werben!!!!!
01.10.2014, 10-11.30 Uhr: AG LOC, Videokonferenz
07.10.2014, 9-12.30 Uhr: LEF-Vorstandssitzung
09.10.2014, 9-12 Uhr: AG Gesundheit, LEF-Geschäftsstelle
11.10.2014, 9-16 Uhr: LEFino-Qualifizierung, erster Praxistag
16.10.2014, 9-18 Uhr: BWL-Fortbildung, 2. Modul "Personalverwaltung"
18.10.2014, 9-16.30 Uhr: Eltern-Kind-Qualifizierung, Baustein 2
18.10.2014, 9-16.30 Uhr: LEF-Fortbildung 2.6: Kursleitertreff für LEFino- und Eltern-Kind-Gruppenleitungen. Haus Birkach
21.10.2014, 9-18 Uhr: EAEW-Jahrestagung, Bad Boll
23.10.2014, 9-13 Uhr: AG Junge Familie
Redaktion: Kerstin Schmider
|
|