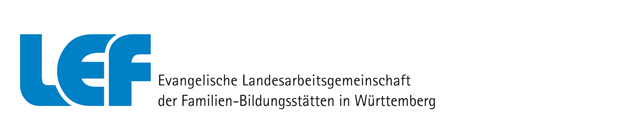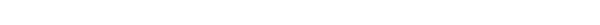| |
Liebe Mitglieder der LEF,
die LEF wünscht Ihnen einen wunderschönen Frühlingsanfang und frohe Ostern! Starten Sie mit neuen Ideen in den Frühling. Viele davon können Sie hier in diesem Newsletter finden.
Es gibt ein neues Kapitel: (5) Flüchtlinge. Die Nachrichten, Programme und aufgelegte Projekte - bundes-, landes- und kirchenweit - mehren sich, so dass sich ein eigenes Kapitel diesem Thema widmet. Überlegen Sie vor Ort, was Sie tun können!
Folgende Kapitel finden Sie im Newsletter:
(1) LEF-Interna
(2) Fortbildungen, Tagungen und Veranstaltungen
(3) Kirche und Politik
(4) Projekte und Projektgelder
(5) Flüchtlinge
(6) Frühe Hilfen
(7) Statistik und Studien
(8) Literatur und Veröffentlichungen
(9) Sonstiges
(10) LEF-Termine im Überblick
Aus der LEF-Geschäftsstelle:
LEF-Fortbildungen:
Die LEF bietet drei Abrufveranstaltungen für Familien-Bildungsstätten an. Diese Veranstaltungen können Sie als Komplettpaket zum angegebenen Preis bei der LEF buchen und mit Ihren Angestellten und/oder Kursleitungen vor Ort durchführen. Sie bestimmen dann selbst, wann und zu welchem Preis Sie diese Fortbildunge in Ihrem Haus anbieten.
Folgende Abrufveranstaltungen stehen zur Auswahl:
6.1 "Wir wollen alle!" - Schritte zur Öffnung Ihrer FBS. Ein Workshop.
Geeignet für Organisationsentwicklungsprozesse oder auch als interkulturelle Schulung für Kursleitungen
Referentin: Inge Mugler. Weitere Informationen
6.2 "Lasst uns über Geld reden!" Honorarmitarbeit an der FBS.
Geeignet als Informationsveranstaltung für Kursleitungen und Personalverantwortliche.
Referent: Christoph Tangl. Weitere Informationen
6.3 Vielfalt. Leben: Handlungskompetenzen mit und für schwierige Teilnehmer/innen entwickeln.
Geeignet für Kursleitungen aus allen Fachbereichen.
Referentin: Sabine König. Weitere Informationen
Neues zum Thema STÄRKE:
Die Projektgruppe Stärke (Mitglied dieser Gruppe ist auch D. Lipkow) hat im Sozialministerium getagt, Hauptpunkt waren die "Hinweise zur Durchführung von Familienbildungsfreizeiten".
Folgendes wurde verabschiedet:
- Der maximale erstattungsfähige Beherbergungs- und Verpflegungsbetrag für eine siebentägige Freizeit beträgt pro Familie
- 2 Erwachsene, 2 Kinder: 660 EUR (früher (600)
- 1 Erwachsene, 2 Kinder: 480 EUR (früher 450) zusätzliche zahlungspflichtige Kinder(also 3 Jahre und älter): 150 EUR. (unverändert)
- Pauschale für Übernachtung und Verpflegung Betreuer/Referenten: 300 EUR
(unverändert)
Damit bleiben als Bildungszuschuss pro Familie 340 EUR bzw. 520 EUR bei Ein-Eltern-Familien.
Die Kreise (Jugendämter) sind zur Kooperation aufgefordert, in den KVJS-Regionaltreffen sollen Stärke-Projekte gegenseitig vorgestellt werden, besonders solche, deren Zielgruppe in einem Kreis wohl zu wenig Teilnehmer erwarten ließe.
Eine Stärke-Freizeit soll sieben Tage dauern, Abweichungen sind in begründeten Fällen möglich.
Neu: Modellhaft sollen Familienbildungswochenenden über Stärke bezuschussbar sein!
Die neuen "Hinweise" werden in den nächsten Tagen auf der Website des Sozialministeriums veröffentlicht.
Zentrale Prüfstelle Prävention:
Zur Durchführung von Präventionskursen, deren Gebühren von den Krankenkassen (teilweise) erstattet werden, bedarf es seit letztem Jahr einer Zertifizierung durch die von den Krankenkassen neu eingerichtete Zentrale Prüfstelle Prävention. Nur Kurse, die dort in einem sehr aufwändigem Verfahren eingegeben wurden und den (oft unklaren) Anforderungen entsprechen, können noch mit den Krankenkassen abgerechnet werden. Der Ansprechpartner für diese Prüftstelle ist der VDEK (Verband Deutscher Ersatzkassen). Die Sportverbände genießen hier eine (unakzeptable) Sonderstellung und können ihre Kurse leichter zertifizieren lassen als z.B. die Bildungseinrichtungen der Erwachsenenbildung. Entgegen vieler Gerüchte hat der VHS-Verband kein Sonderabkommen mit dem VDEK. Präventionskurse, die bei den VHSen noch als solche ausgeschrieben werden, sind lediglich "Altlasten", deren Zertifizierungen im Laufe diesen Jahres auslaufen. Dann stehen die VHSen vor dem gleichen Problem wie schon viele FBSen.
Allerdings befindet sich die ZPP noch in einer Probephase und es ist recht wahrscheinlich, dass das bestehende System noch einmal überarbeitet wird.
Vorgehen der LEF: Die LEF befindet sich in enger Absprache mit den beiden Bundesverbänden eaf-Forum Familienbildung und der kath. bag. Ziel ist ein aufeinander abgestimmtes Vorgehen, das voraussichtlich die Verfassung eines Briefes an die entsprechenden Ministerien der Länder und an den VDEK vorsieht, der dann von allen Verbänden der Familienbildung verschickt werden soll.
Ein vorübergehendes Verfahren zur leichteren Erlangung von Zertifikaten durch die ZPP wird die LEF in der AG Gesundheit (23.4.2015) durchdenken: evtl. könnte die Einrichtung einer Online-Gruppe auf der www.evangelische-bildung-online-wue.de zum Austausch bereits zertifizierter Stundenbilder Sinn machen.
Väterprojekt FBS-VHS:
Am 23.04.2015 fand der Fachtag „Väter in der Familienbildung" statt. Zwei Inputvorträge am Vormittag und Workshops am Nachmittag ergaben einen runden Fachtag rund um das Thema Väter. Die Vorträge und Inputs der workshops werden auf der Homepage der LEF unter Angebote/Projekte veröffentlichet.
Die Bewerbungsfrist für die Teilnahme am Väterprojekt endet am 27.03. Ausschlussfrist.
LEFino:
Die LEFino-Qualifizierung der LEF musste dieses Jahr mangels Anmeldezahlen abgesagt werden.
LEFino ist ein Marken- und Nischenprodukt der Familien-Bildungsstätten in Württemberg, das nur funktioniert, wenn möglichst alle Familien-Bildungsstätten auch LEFino-Kurse in ihren Einrichtungen anbieten.
Die LEFino-Kursleiter/innen werden von der LEF gut ausgebildet. Sie sind für mindestens 2 Jahre an die entsendende FBS gebunden und leisten gute Arbeit vor Ort. Mit dem gerade entstehenden LEFino-Elternbuch gibt es nun auch ein Produkt, das die Eltern in der Hand haben und mit nach Hause nehmen können. Es wird die Arbeit der LEFino-Kursleiterinnen aufwerten und den Kursen ein einzigartiges Profil verleihen. Die zentralen Leitlinien von LEFino werden in einfacher und leicht verständlicher Sprache kurz und knapp dargestellt. LEFino-Lieder, Fingerspiele und vieles mehr gibt es im Praxisteil mit Erläuterungen - auch für Eltern mit Migrationshintergrund.
Für Ihr nächstes Semesterprogramm: Denken Sie schon jetzt daran, die Ausschreibung zur nächsten LEFino-Qualifizierung mitaufzunehmen (ab Februar 2016).
Scheinselbständigkeit:
In der AG JuFa gibt es eine Zusammenfassung der LEF zum Thema Scheinselbständigkeit (unter den Dokumenten) sowie einige exemplarische Honorarverträge aus anderen Landeskirchen zur Orientierung.
Aus der KILAG:
- Das Bildungszeitgesetz kommt zum definitiv zum 1.07.2015. Einrichtungen die Weiterbildungsangebote zur Qualifizierung anbieten und die Freistellungstage des BZG in Anspruch nehmen wollen, müssen zertifiziert sein. Ein Antrag auf Aufnahme in eine dafür vorgesehene Stelle beim RP Karlsruhe wird wohl notwendig werden. Die RVO (Rechtsverordnung) zum Gesetz wird gerade erarbeitet.
- Die KILAG entwickelt im Moment ein Modul als Fachtag zur Unterstützung von Ehrenamtlichen die mit traumatisierten Flüchtlingen arbeiten. Dieser Fachtag wird in den jeweiligen Landeskirchen angeboten werden.
- Die Landesregierung arbeitet über ihre Verwaltungsbehörden (KM und SM) im Moment sehr intensiv daran, wie die Arbeit mit Flüchtlingen auch von Ehrenamtlichen finanziell unterstützt werden kann. Hierfür sind unterschiedliche Überlegungen/Ansätze im Gespräch. Für die FBSen könnte die Qualifizierung und Begleitung von Ehrenamtlichen interessant sein.
Deutschlandweite Trends aus NEKED (Netzwerk Evangelischer und Katholischer Eltern-Kind-Gruppen in Deutschland):
- Familienbildung ist "in" - ist institutionelle Familienbildung "out"? Wie muss institutionelle Familienbildung aussehen, damit sie die Bedarfe der Familien trifft (und zwar über alle Lebensphasen hinweg?)
- Offene Treffs: Entwicklung neuer Formate (z.B. Familien-Lounge, Baby-Lounge), bei denen die professionelle Organisation und die Durchführung von offenen Treffs durch Fachkräfte - z.B. in Gemeindehäusern - "verkauft" werden. Es gibt 45 Treffen pro Jahr zu einem Preis von 2500,- (Einrichtung der kath. Familienbildung in Frankfurt).
- Arbeit mit Flüchtlingen an Familien-Bildungsstätten ist ein großes Thema. Finanzierung durch Stadt/Kommune oder Kirche.
- Allgemeiner Trend: Familien brauchen Orte, an denen sie sich wohlfühlen, die unverplante Qualitätszeit unverbindlich - aber mit professioneller Beratung und Unterstützung - zur Verfügung stellen
- Boom: Indoorspielplätze mit Elterncafe in FBSen
- FBS macht Elternbildung in KiTa´s
-
www.digitale-elternbildung.de : Diese Internetseite wurde von der EKHN (Evang. Kirche Hessen-Nassau) erstellt und bietet sowohl Eltern als auch Kursleitungen viele Informationen rund um das Thema Eltern/Erziehung/Rituale, etc.
- Durchführung von Ferienbetreuung nimmt zu
- Die Nachfrage nach religiösen Angeboten nimmt zu
- Die Bedeutung von informellen Lernen nimmt zu
- Aktion des Kinderschutzbundes in Frankfurt: "Sprechen Sie mit Ihrem Kind!" Eltern am Smartphone: Eine Gefahr für die Bindung zum Baby?
Aus den Häusern:
Die FBS Waiblingen veranstaltet eine Fortbildung zum Thema: „Wir nehmen jeden!" Die FBS auf dem Weg zur Inklusion
Fortbildung und Gesprächsrunde zum Umgang mit Kursteilnehmer/innen mit Behinderung
Wann? am Mittwoch, den 11.11.2015 von 19 Uhr bis 21 Uhr
Wo? in der FBS Waiblingen, Alter Postplatz 17
Inklusion bedeutet, dass alle Menschen mit und ohne Behinderung überall und gleichberechtigt dabei sein können: in der Schule, am Arbeitsplatz, im Wohnviertel und auch in der FBS.
Die FBSen haben sich auf den Weg gemacht, „inklusive" Einrichtungen zu werden und möchten Barrieren für behinderte Menschen abbauen und Ihnen die Teilhabe am eigenen Bildungsangebot vereinfachen. Das bedeutet, dass Menschen mit Behinderung in den FBS- Kursen herzlich willkommen sind. Zum Teil wird dies schon ohne Probleme in der Praxis gelebt. Manchmal gibt es jedoch auch Schwierigkeiten, da es nicht immer einfach ist, Teilnehmer mit Behinderungen in einen Kurs zu integrieren. Weitere Informationen finden Sie auf der LEF-Homepage in der Rubrik "Fortbildungen" unter "Angebote unserer Mitgliedseinrichtungen":
Tagung "Am Puls des Ichs - Unterwegs in eine narzisstische Mediengesellschaft?
Wann? 15. April 2015
Wo? Haus der Katholischen Kirche in Stuttgart
Veranstalter: Bischöflichen Medienstiftung der Diözese Rottenburg-Stuttgart, dem Institut für Digitale Ethik der Hochschule der Medien, Stuttgart und dem SWR
Anmeldung und weitere Informationen unter http://tagung.medienstiftung.info
2. Regionalkonferenz zu Kinder- und Jugendrechten der FaFo
Wann? 20.04.2015
Wo? Waiblingen
Das Veranstaltungsprogramm finden Sie hier.
Symposium: SGB V & VIII: Wunsch oder Vision?
Wann? 27. April 2015, 10-16.30 Uhr
Wo? Frankfurt
Die Initiatoren der "BAG Gesundheit und Frühe Hilfen" laden zu einem Symposium mit dem Thema: „SGB V & VIII: Wunsch oder Vision?" nach Frankfurt ein.
Die Veranstaltung wird vom Nationalen Zentrum Frühe Hilfen sowie von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V., vom Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen in Rheinland-Pfalz und der Crespo-Foundation unterstützt. Weitere Informationen hier.
Vielfalt und Vorurteile in der (Familien)Bildung
Wann? 28.4.2015, 11 Uhr - 29.4., 15 Uhr
Wo? Kassel
Veranstalter: eaf Forum Familienbildung
Es gibt noch freie Plätze. Weitere Informationen s. Flyer im Anhang
10 Jahre Stiftung Kinderland mit großem Festival
Die Stiftung Kinderland feiert ihren 10. Geburtstag. Unter dem Motto „Alles was erzählt" schenkt sie Kindern und Jugendlichen im Land vom 1. bis 15. Juli ein Erzähl- und Geschichtenfestival.Für dieses werden noch Mitwirkende gesucht: Ob Erzählstunden, Lesungen, Schreibworkshops, Theateraufführungen oder musikalisch und darstellerische Angebote – der Kreativität sind (fast) keine Grenzen gesetzt. Darüber hinaus gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich daran zu beteiligen. Ob als Künstler mit eigenem Veranstaltungsangebot oder als Gruppe, die ein kostenfreies Angebot bucht oder als Organisation, die ein eigenes Veranstaltungsformat anbietet.
Ihre Ideen können Sie hier bis zum 27.März 2015 einreichen.
62. Internationalen Konferenz der International Commission on Couple and Family Relations (ICCFR)
Changing Times: Impacts of time on family life"
Wann? 22.-24. Juni 2015
Wo? Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Reichpietschufer 50, 10785 Berlin
Veranstalter: ICCFR dieses Jahr in Kooperation mit der AGF und dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)
Im Rahmen der Konferenz werden sich Expert/innen unterschiedlicher Professionen zum Thema Zeit und Familie austauschen und dieses aus politischer und rechtlicher Perspektive sowie aus Sicht der Familienberatung betrachten.
Auszüge aus dem Programm:
- Empfang im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit Staatsekretärin Caren Marks am Montag, 22. Juni
- Vorträge von Prof. Dr. Jutta Allmendinger (WZB) und Prof. Dr. Jean-Pierre Vanhee (Belgien) sowie einer Pro-Contra-Diskussion mit Lloyd Godson/Grant Howell (USA/Großbritannien)
- Insgesamt neun Arbeitsgruppen (jeweils vier bzw. fünf parallel) am Dienstag und Mittwoch
- Diskussionsgruppen zur weiteren Reflektion der Vorträge und zum internationalen wie interprofessionellen Austausch
- Rahmenprogramm am Dienstag und Mittwoch zum Kennenlernen und Gedankenaustausch
Die Konferenzsprache ist Englisch. Die zwei Vorträge und die Pro-Contra-Diskussion werden jeweils simultan Deutsch - Englisch übersetzt. Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie auf unserer Website unter: http://www.ag-familie.de/iccfr2015
Reise "Reformation - zwischen Revolution und Reaktion"
Wann? August 2015
Veranstalter: Evangelische Erwachsenenbildung Leonberg
Ausführliche Reiseunterlagen können unter info@ewb-leonberg.de oder auf der Homepage ewb-leonberg.de angefordert werden.
Weitere Informationen s. Flyer in der Anlage
4. Fachtagung Demografie – Generationenpolitik
"Generationendialog – Mehrgenerationenhäuser als Chance im Quartier"
Wann? 20. Juli 2015
Wo? Evangelische Akademie Bad Boll
Veranstalter: Soziallministerium
Die Fachtagung richtet sich insbesondere an Verantwortliche aus Politik und Verwaltung in den Kommunen, Generationentreffs, Treffs von Jung und Alt, Sozialraumorientierte Gruppen, Nachbarschafts- und Quartiersgruppen, Projekte einer lebendigen Nachbarschaft, Interessierte aus den Kirchen und Wohlfahrtsverbänden, die Netzwerke der Mütterzentren, der Mehrgenerationenhäuser und des bürgerschaftlichen Engagements.
Der Link führt direkt zum Programm und zur Anmeldung
Weiterqualifizierung Elternchance ist Kinderchance
Das Bundesprogramm Elternchance ist Kinderchance des BMFSFJ ist ein großer Erfolg! Seit 2011 werden Fachkräfte der Familienbildung zu Elternbegleiter_innen weiterqualifiziert. Die DEAE beteiligt sich neben fünf weiteren Verbänden, die sich zu einem Trägerkonsortium zusammengeschlossen haben, an der Weiterqualifizierung.
Ab Juli 2015 startet das Projekt voraussichtlich in eine zweite Förderphase, so dass es ab September 2015 vorbehaltlich der formalen Bewilligung einer Projektfortführung weitere Kurse der Weiterqualifizierung zur Elternbegleiterin/zum Elternbegleiter geben wird.
Interessent_innen können sich schon jetzt registrieren lassen, indem sie eine Mail an die Koordinatorin Martina Nägele schicken, mit Namen, Kontaktdaten, derzeitiger Tätigkeit (mit Einrichtung) und Wunschregion für einen Kurs. Frau Nägele wird alle Interessent_innen umgehend informieren, sobald neue Kurstermine feststehen. Mail: mnaegele@deae.de
Start des Ideenwettbewerbs der Evangelischen Landeskirche in Württemberg - eine Mitteilung unserer Landeskirche
"Am 21. März 2015 werden der Ideenwettbewerb der Evangelischen Landeskirche in Württemberg gestartet und die dazu gehörige Internetseite freigeschaltet, aber schon jetzt können Sie auf Facebook und Twitter die weitere Entwicklung verfolgen und wie es so schön heißt „Fan" des Ideenwettbewerbs werden und die Infos mit anderen teilen. Ab dem 16. März, dem Datum der Pressekonferenz, werden sicher viele Medien vorab darüber berichten.
(...) Mit dem ganzjährig verwendbaren Backförmchen wollten wir (...) ein wiederkehrendes Motiv des Wettbewerbs bekannt machen: Die Sprechblase. Noch ohne Füllung. Denn Sie haben das Wort und möglichst viele andere Menschen im Bereich unserer Landeskirche auch. Und wir hören hin. Ohne Voreingenommenheit. Die besten Ideen sollen zum Zug gekommen.
Welche Ausschreibungskategorien wird es geben? Wie kann man sich beteiligen? Wer sucht die besten Ideen unter den Einreichungen aus? Sie werden es wieder aus erster Hand erfahren. Einmal durch den Newsletter, den Sie unter www.kirche-macht-was.de abonnieren können, zum Zweiten durch ein Informationspaket mit nützlichen Infos, Unterlagen, Postkarten und Plakaten, das Ihnen in noch vor dem Start des Wettbewerbs zugestellt wird."
Glaube bewegt – eine Initiative der SportRegion Stuttgart
Worum es geht!
Die SportRegion Stuttgart nimmt den Evangelischen Kirchentag zum Anlass, sich in den kommenden Monaten verstärkt den Themenfeldern „Kirche, Glaube und Sport" zu widmen. GLAUBE BEWEGT! lautet in diesem Zusammenhang das Jahresmotto 2015 der SportRegion Stuttgart. Herzstück soll dabei eine 365-Tage-Projekt sein. Bei der Internet-Aktion DARAN GLAUBE ICH! sind die Menschen in der Region Stuttgart aufgefordert mitzuteilen, woran sie glauben, was sie beim Sport motiviert und welche Bräuche sie haben, die ihnen Glück bringen sollen. Ziel ist es, ein ganzes Jahr lang kreative Aussagen zu verschiedenen Aspekten des Glaubens im Sport einzufangen. Die Antworten werden dann auf einer speziellen Seite im Internet veröffentlicht – an jedem Tag des Jahres 2015 eine andere.
Kernfragen
Die Fragen, die in diesem Zusammenhang in drei bis fünf Sätzen beantwortet werden sollen, lauten:
- Wo spielt der Glaube (oder Aberglaube) in Deiner Sportart und bei Deinem Sport eine Rolle?
- Welche Rituale gibt es?
- Warum machst Du das?
Beispiele:
„Mich motiviert es, wenn ich an einem Spieltag in ein volles Stadion einlaufe. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man den Rasen betritt und alles um einen herum schreit. Als Profi darf ich Woche für Woche meinen Traum leben – und dafür bin ich sehr dankbar."
„Ich bin Sportfunktionär. Das ist ein Begriff, den ich eigentlich nicht mag. Er beschreibt aber eines ganz gut, nämlich worum es mir geht: ich funktioniere! Ich diene meinem Sport und ich setze mich für diejenigen ein, die diese Sportart gerne mache. Das ist für mich Motivation genug."
Bei Familienförderung geht es nicht nur um Kosten, sondern um Chancen: Verbände kritisieren das „Familienpaket" des Bundesfinanzministeriums
Der vom Bundesfinanzministerium am 6. März 2015 vorgelegte Gesetzentwurf zur Erhöhung von Kinderfreibetrag, Kindergeld und Kinderzuschlag ist vollkommen unzureichend. Es gäbe jetzt die Chance, die Vorschläge durch die Beteiligung der zuständigen Bundesfamilienministerin sowie der Verbände zu verbessern.
Lesen Sie die gesamte Pressemeldung hier.
Gemeinsame Pressemitteilung vom AWO Bundesverband e. V., Deutscher Juristinnenbund e. V., Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e. V., Deutsches Kinderhilfswerk e. V., evangelische arbeitsgemeinschaft familie e. V., Familienbund der Katholiken e. V., Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bundesverband e. V., Zukunftsforum Familie e. V. zum "Familienpaket" des Bundesfinanzministeriums (13.3.2015).
Bundesfamilienministerium: Kita-Ausbau geht voran
Das Bundeskabinett hat am 4. März den fünften Bericht zur Evaluation des Kinderförderungsgesetzes (KiföG) beschlossen. Darin wird erstmals seit Inkrafttreten des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz die Betreuungssituation in ganz Deutschland seit 2008 bewertet. Hierzu wurden auch Eltern, Jugendämter, Kindertageseinrichtungen und ihre Mitarbeiterinnen sowie Tagespflegepersonen befragt.
Der Kita-Ausbau geht mit hohem Tempo voran: Am 1. März 2014 wurden in Deutschland 660.750 Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen oder der öffentlich geförderten Kindertagespflege betreut – das sind fast 300.000 Kinder mehr als im Jahr 2008. Die Betreuungsquote der unter Dreijährigen stieg damit zwischen 2008 und 2014 von 17,6 Prozent auf 32,3 Prozent. Einen Betreuungsplatz wünschen sich jedoch 41,5 Prozent der Eltern mit Kindern unter drei Jahren. Daher muss der Ausbau auch in den kommenden Jahren weitergehen.
Sowohl die Betreuungsquote als auch der Bedarf nach Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren unterscheiden sich stark zwischen den einzelnen Bundesländern. Die Differenz zwischen Betreuungsbedarf der Eltern und Betreuungsquote der Kinder unter drei Jahren war 2014 in Westdeutschland mit 10,2 Prozentpunkten fast doppelt so hoch wie in Ostdeutschland mit 5,4 Prozentpunkten. Der rasante Betreuungsausbau ging nicht zu Lasten der Qualität: Sowohl Personalschlüssel als auch Gruppengrößen blieben über die Jahre hinweg konstant.
Weitere Informationen finden Sie unter www.bmfsfj.de und www.fruehe-chancen.de
Quelle: Pressemitteilung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 4.3.2015
Fördermittel zur Verbesserung des Zugangs von zugewanderten Kindern zu Angeboten der frühen Bildung
Aktuelle Informationen zum EHAP, dem Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen
Ab September 2015 ist in ganz Deutschland die Förderung von Projekten geplant, die sich an besonders benachteiligte Menschen richten, ein diesbezügliches Interessenbekundungsverfahren soll erst im Mai starten.
Programmschwerpunkte sind
- die Verbesserung des Zugangs von besonders benachteiligten EU-Zugewanderten zu Beratungs- und Unterstützungsleistungen des regulären Hilfesystems
- die Verbesserung des Zugangs von zugewanderten Kindern zu Angeboten der frühen Bildung und der sozialen Inklusion
- die Verbesserung des Zugangs wohnungsloser und von Wohnungslosigkeit bedrohter Personen zu Beratungs- und Unterstützungsleistungen des regulären Hilfesystems
Finanziert werden in erster Linie zusätzliche Beratungs- und Orientierungsleistungen auf niedrigschwelliger Ebene. Diese sollen auf bestehenden Strukturen aufbauen und sie in ihrer Wirkung verstärken. Der EHAP erfüllt somit eine Brückenfunktion zwischen bereits bestehenden Angeboten der Beratung und Unterstützung und den Zielgruppen. Es geht darum, Menschen an bestehende Angebote heranzuführen und diese damit in ihrer Wirkung zu verstärken. Rein materielle Unterstützungsleistungen können aus dem EHAP nicht gefördert werden.
Voraussetzung für eine Förderung ist die Zusammenarbeit in Kooperationsverbünden zwischen Kommunen und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege oder anderen gemeinnützigen Trägern. Jeder dieser Kooperationspartner kann Antragsteller bzw. Zuwendungsempfänger sein.
Dabei könnten Schwerpunkt 1 und vor allem Schwerpunkt 2 auch für Familienbildungsstätten bzw. für deren Verbünde interessant sein. Insbesondere könnte man an den Einsatz der bereits ausgebildeten Elternbegleiter/innen denken.
In Schwerpunkt 2 soll zum Beispiel für Kinder von EU-Zuwanderer/innen der Zugang zu bereits bestehenden Angeboten, wie Kindertageseinrichtungen oder pädagogisch begleitete Kindergruppen, verbessert werden. Den Kindern soll damit frühzeitig eine Perspektive auf eine erfolgreiche Bildungslaufbahn eröffnet werden. Dieser Förderbereich wurde in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) erarbeitet, damit sich die Angebote des Bundes ergänzen und in ihrer Wirkung verstärken.
Konkret handelt es sich bei der anvisierten Zielgruppe um Zuwanderer/innen aus Südosteuropa.
Den Text des zugrundeliegenden operativen Programms finden Sie hier.
Weitere Informationen finden Sie auf der EHAP-Webseite unter www.ehap.bmas.de oder schreiben Sie an ehap@bmas.bund.de . Die Förderrichtlinie und die Auswahlkriterien werden im Mai 2015 auf der EHAP-Webseite veröffentlicht.
Quelle: eaef-Forum Familienbildung
FaFo: Ideenwettbewerb der Robert Bosch Stiftung für eine bessere Mobilität im Alter Kleine Schritte – große Wirkung
http://www.familienfreundliche-kommune.de/FFKom/Aktuelles/detail.asp?20150304.3.xml
Ausschreibung für Heinz - Westphal - Preis gestartet: Engagement von Jugendlichen im Rampenlicht
Ob bei der Feuerwehr, im Sportverein oder in der Schule - jeder dritte Jugendliche in Deutschland engagiert sich freiwillig. Der Heinz-Westphal-Preis rückt dieses ehrenamtliche Engagement ins Rampenlicht. In diesem Jahr vergeben das Bundesjugendministerium und der Deutsche Bundesjugendring die Auszeichnung bereits zum neunten Mal - und zwar in den Kategorien Integration, Vielfalt, digitale Medien sowie europäische und internationale Zusammenarbeit.
Die Ausschreibung läuft bis zum 18. Mai 2015. Gesucht werden Projekte und Aktionen, die das ehrenamtliche Engagement junger Menschen ermöglichen, stärken oder Jugendliche zu freiwilliger Arbeit motivieren. Die fünf Preisträgerinnen und Preisträger erhalten eine Prämie von je 3.000 Euro. Außerdem vergibt die Stiftung "Jugend macht Demokratie" einen Sonderpreis in Höhe von 3.000 Euro für besonderes ehrenamtliches Engagement junger Menschen in den Bereichen Demokratieförderung und Partizipation.
Bewerben können sich Jugendverbände, Jugendringe oder sonstige Organisationen der Jugendarbeit, die sich mit den Themen Vielfalt, digitale Medien, Inklusion oder europäische und internationale Zusammenarbeit beschäftigen. Diese Projekte sollten direkt vor Ort im unmittelbaren Lebensumfeld etwas verändern, Impulse setzen oder die Qualität ehrenamtlicher Arbeit verbessern.
Weitere Informationen über den Heinz-Westphal-Preis und die Teilnahmebedingungen gibt es unter www.heinz-westphal-preis.de
Verlängerung des Programms „Nachhaltigkeit lernen- Kinder gestalten Zukunft" der Baden-Württembergstiftung
Die Baden-Württemberg Stiftung hat 2011 in Kooperation mit der Heidehof Stiftung ein Programm aufgelegt, das Kindern spielerisch den Zugang zu Umwelt- und Naturschutzthemen eröffnen soll. 14 Modellprojekte haben sich daran beteiligt. Bei der Abschlussveranstaltung für den ersten Durchgang am 23. Februar im Hospitalhof in Stuttgart gaben Umweltminister Franz Untersteller und Stiftungsgeschäftsführer Christoph Dahl die Verlängerung des erfolgreichen Programms bekannt.
Ziel des Programms ist es, Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren für die Belange des Naturschutzes, des Biodiversitätserhalts, der Umweltvorsorge und der nachhaltigen Entwicklung zu sensibilisieren. Nach dem Prinzip „Nachhaltigkeit vorleben und aktiv erlernen" soll Umweltbewusstsein entwickelt und gefördert werden. Im Rahmen von zwei Ausschreibungen konnten Träger von Kindergärten und Kindertageseinrichtungen, gemeinnützige oder öffentlich-rechtliche Einrichtungen, Körperschaften, Verbände und Organisationen mit Sitz in Baden-Württemberg Anträge mit ihren Projektideen einreichen.
Im Sommer 2011 wurden 14 Projekte ausgewählt, die über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren im Rahmen des Programms umgesetzt wurden. Im Sommer 2013 wurden 30 neue Projekte im Land ausgewählt, die momentan durchgeführt werden.
Weitere Informationen hier.
Fonds der Landeskirche für Flüchtlingsprojekte
Mit dem Fonds „Kleinprojekte mit und für Flüchtlinge" unterstützt die Evangelische Landeskirche in Württemberg die Flüchtlingsarbeit von Kirchengemeinden, diakonischen Einrichtungen und Diensten. Zur Verfügung stehen 350.000,- Euro, die für Maßnahmen wie z.B. Aktionen für Kinder, Asylcafés etc. abgerufen werden können.
Die Verwaltung des Fonds erfolgt durch das Diakonische Werk Württemberg, für die Vergabe der Mittel wurde ein Beirat eingesetzt. Die Antragstellung ist unkompliziert, aufgrund der begrenzten finanziellen Ressourcen jedoch im Zeitraum 2015/16 nur einmal pro Kirchengemeinde/Kirchlich-diakonische Dienststelle möglich. Weitere Informationen sowie das Antragsformular finden Sie unter www.diakonie-wuerttemberg.de/flucht-und-asyl
Land erleichtert Flüchtlingen den Zugang zu Sprache und Arbeit
Mit einem neuen Programm ermöglicht die Landesregierung Flüchtlingen den frühzeitigen Erwerb der deutschen Sprache und baut damit Zugangshürden zum deutschen Arbeitsmarkt ab. Das Land setzt damit einen weiteren wichtigen Punkt des Flüchtlingsgipfels im vergangenen Oktober um und investiert rund 4,4 Millionen Euro in das Programm „Chancen gestalten - Wege der Integration in den Arbeitsmarkt öffnen". Mit dem Programmteil ihres Ministeriums will Sozialministerin Altpeter Flüchtlinge bei einem möglichst frühzeitigen Einstieg in die Arbeitswelt unterstützen.
Berufliches Potenzial der Flüchtlinge nutzen
Eine erhebliche Zahl von Flüchtlingen habe eine höhere Schulbildung, bringe berufliche Qualifikationen mit, weise ausbaufähige berufliche Fähigkeiten auf oder komme für eine reguläre Ausbildung in Betracht. Die Menschen seien jedoch insbesondere sprachlich nicht für eine Arbeitsaufnahme vorbereitet. Öney: „Fehlende Deutschkenntnisse sind vielfach der entscheidende Engpass bei der Hinführung zum Arbeitsmarkt. Bislang erheben wir auch keine beruflichen Qualifikationen und Fähigkeiten, folglich bleiben sie oft ungenutzt."
Sozialministerin Altpeter will mit dem Programmteil ihres Ministeriums dazu beitragen, dass Flüchtlinge frühzeitig arbeitsmarktnah aktiviert werden. Flüchtlinge sollen deshalb an zunächst fünf Standorten in Mannheim, Ludwigsburg, Karlsruhe, Albstadt und Tübingen die Möglichkeit bekommen, praktische Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln.
Sechs Bausteine für bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt
Das neue Programm der Landesregierung soll bestehende Sprachangebote öffnen, berufliche Praktika ermöglichen, bisher fehlende Informationen bereitstellen, die Steuerungsfunktion der Stadt- und Landkreise stärken sowie das Zusammenspiel in Netzwerken vor Ort fördern. Die Maßnahmen sollen anschlussfähig sein und Flüchtlingen Optionen auf weiterführende Angebote eröffnen. Die Initiative betrifft nicht allein neu eingereiste Flüchtlinge und Asylbewerber, sondern - bei entsprechendem Bedarf - auch Menschen, die sich schon länger im Land aufhalten.
Weitere Informationen hier: hier
Empfehlungen zu Basiskompetenzen in den Frühen Hilfen - Beitrag des NZFH-Beirats
Die Arbeitsgruppe (AG) Qualifizierung des NZFH-Beirates gibt in einer Broschüre Empfehlungen zu Basiskompetenzen in den Frühen Hilfen von Berufsgruppen, die in ihrem professionellen Kontext mit Familien und deren Kleinkindern zusammenarbeiten. Die Empfehlungen sind als Reflexionsfolie für Anbieter von Fort- und Weiterbildungen gedacht und in der Reihe Kompakt des NZFH erschienen. Die DIN A5 Broschüre umfasst 16 Seiten und kann kostenlos über die Internetseite www.fruehehilfen.de bestellt werden.
Neues aus der FaFo:
Kompetenzzentrum Beruf & Familie Baden-Württemberg und Landratsamt Enzkreis kooperieren | Landratsamt Enzkreis startet das "Programm familienbewusst & demografieorientiert"
http://www.kompetenzzentrum-bw.de/FFBetr/Aktuelles/detail.asp?20150226.1.xml
Zeichen setzeN! - Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg am 12.-13. Juni 2015 |
Jetzt Aktionen anmelden!
http://www.kompetenzzentrum-bw.de/FFBetr/Aktuelles/detail.asp?20150226.3.xml
Frauen und Männer am Arbeitsmarkt: Traditionelle Erwerbs- und Arbeitszeitmuster sind nach wie vor verbreitet
Das Institut für Arbeitsmarkt und Beschäftigung (IAB) hat in seinem jüngsten Kurzbericht (4/2015) die Arbeitszeitmuster von Frauen und Männern analysiert.
Die Befunde in Kürze:
- Der Anteil der Frauen an den Beschäftigten ist seit 1991 um 5,0 Prozentpunkte gestiegen. Damit war 2014 fast die Hälfte aller Beschäftigten weiblich. Ihr Anteil am Arbeitsvolumen nahm um 3,4 Prozentpunkte zu und lag 2014 bei knapp 41 Prozent. Dabei konzentrierte sich der Anstieg auf Teilzeitarbeit einschließlich der geringfügigen Beschäftigung.
- Die Zahl der beschäftigten Frauen stieg insgesamt um 21 Prozent, das von ihnen geleistete Arbeitsvolumen um 4 Prozent. Ein etwas höheres Arbeitsvolumen wird heute also von deutlich mehr Arbeitnehmerinnen erbracht als früher.
- Vor allem in der Familienphase verfestigen sich die Unterschiede in den Arbeitszeiten und ein Großteil der Paare wählt das „Zuverdienermodell" mit vollzeitbeschäftigtem Mann und teilzeitbeschäftigter Frau.
- Die Arbeitszeitpräferenzen von Paaren zeigen, dass sich bei einer Realisierung der gewünschten Wochenarbeitszeiten an der Verteilung der partnerschaftlichen Erwerbszeit nur wenig ändern würde.
- Bessere Kinderbetreuungsangebote und flexible Arbeitszeitmodelle, aber auch eine finanzielle Förderung von partnerschaftlichen Erwerbsmodellen könnten zu einer ausgewogeneren Aufteilung von Erwerbs- und Familienzeiten von Paaren beitragen.
Den Kurzbericht finden Sie hier: http://doku.iab.de/kurzber/2015/kb0415.pdf
Private Bildungsausgaben: Einkommensschwache Familien sind relativ stärker belastet
Familien, die Geld für die Bildung ihrer Kinder ausgeben, sind umso stärker belastet, je weniger Einkommen sie haben: Während der entsprechende Anteil am monatlichen Haushaltseinkommen im unteren Fünftel der Einkommensskala bei rund vier Prozent liegt, sinkt er auf gut drei Prozent bei den einkommensstärkeren Familien. Bezieht man auch jene Familien ein, die keine Bildungsausgaben tätigen, entweder weil sie die Angebote nicht nutzen oder von Beiträgen befreit sind, nimmt der Anteil der Bildungsausgaben mit dem Einkommen zu. Das geht aus einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) hervor, die auf Daten des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) und der Zusatzstichprobe Familien in Deutschland (FiD) basiert. Den Berechnungen zufolge gibt in Deutschland jede Familie mit Kindern unter 16 Jahren durchschnittlich – unter Einbezug der 23 Prozent Familien, die nichts ausgeben – etwa 93 Euro pro Monat fü r unterschiedliche Bildungsangebote wie eine Kindertagesstätte, Nachhilfeunterricht oder Freizeitaktivitäten wie Sport- und Musikunterricht aus. Die Familien, die tatsächlich Ausgaben tätigen, wenden monatlich rund 120 Euro auf. (...) Am meisten geben Familien mit einem Anteil von 60 Prozent ihrer Bildungsausgaben für Kindertageseinrichtungen aus. 27 Prozent entfallen auf Freizeitaktivitäten und jeweils sieben Prozent auf Ausgaben für einen kostenpflichtigen Schulbesuch beziehungsweise informelle Bildungs- und Betreuungsmöglichkeiten wie Tagesmütter.
Dass Familien mit geringeren Einkommen, sofern sie tatsächlich Ausgaben tätigen, relativ höher belastet sind, gilt für nahezu alle betrachteten Bildungsangebote, also neben den Ausgaben für eine Kita auch für Freizeitaktivitäten und Nachhilfeunterricht. Insbesondere für die beiden letztgenannten Ausgabenarten geben ärmere Familien seltener Geld aus: Für Freizeitaktivitäten tätigen nur 30 Prozent der einkommensschwächsten Haushalte überhaupt Ausgaben, für Nachhilfeunterricht geben nur sechs Prozent Geld aus. Investieren sie in diesen Bereichen Geld, sind sie mit Ausgaben anteilen von etwa 2,5 beziehungsweise fünf Prozent im Vergleich zu den einkommensstärksten Haushalten (Ausgabenanteil je gut ein Prozent) stärker belastet.
Während die Bildungsausgaben der einkommensschwachen Haushalte fast unabhängig von der Anzahl der Kinder sind, steigen sie in den einkommensstärkeren Haushalten deutlich mit der Kinderzahl.
Zudem tätigen Familien deutlich größere Bildungsausgaben, wenn mindestens ein Elternteil einen akademischen Abschluss hat. „Im Hinblick auf ungleiche Bildungschancen ist auch dieser Befund diskussionswürdig, weil Kinder, die aufgrund der Bildung ihrer Eltern ohnehin schon bessere Chancen haben, zusätzlich noch von höheren Bildungsausgaben profitieren", so Schröder, Spieß und Storck. „Um Bildungspotentiale besser nutzen zu können, wäre es sozialpolitisch überlegenswert, dass man ärmere Familien stärker entlastet, indem man die Beiträge für kostenpflichtige Bildungsangebote stärker als bisher an das Einkommen koppelt."
Die Studie des DIW Berlin analysiert die privaten Ausgaben erstmals vor dem Hintergrund eines breit gefassten Bildungsbegriffs, der auch informelle und non-formale Angebote einschließt. In der amtlichen Statistik werden diese Ausgaben nicht einbezogen. Die DIW-Studie berücksichtigt aus den SOEP- und FiD-Datensätzen des Jahres 2012 alle Familienhaushalte, also alleinerziehende Mütter oder Väter ebenso wie Paarhaushalte, in denen mindestens ein Kind unter 16 Jahren lebt. Dass die Studienergebnisse auch dann erhalten bleiben, wenn andere potentielle Einflussfaktoren wie die Anzahl und das Alter der Kinder in einem Haushalt, der Wohnort oder der Bildungsabschluss der Eltern berücksichtigt werden, haben die DIW-Forscher anhand multivariater Analysen überprüft.
Quelle: Pressemitteilung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung e.V. vom 18.2.2015
Bertelsmann-Studie: Armut ist Risiko für Entwicklung von Kindern
In Deutschland wachsen mehr als 17 Prozent der unter Dreijährigen in Familien auf, die von staatlicher Grundsicherung leben. Wie wirkt sich das auf die Entwicklung dieser Kinder aus? Eine Analyse von Schuleingangsuntersuchungen im Ruhrgebiet zeigt: Armutsgefährdete Kinder sind schon bei Schuleintritt benachteiligt.
Ein Aufwachsen in Armut beeinträchtigt die Entwicklung von Kindern. Schuleingangsuntersuchungen erkennen bei Kindern, deren Familien von staatlicher Grundsicherung leben, mehr als doppelt so häufig Defizite in der Entwicklung wie bei Kindern, die in gesicherten Einkommensverhältnissen aufwachsen. Das belegt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Die Fünf- und Sechsjährigen aus SGB-II-Familien sprechen schlechter Deutsch, können schlechter zählen, leiden öfter unter Konzentrationsmängeln, sind häufiger übergewichtig und verfügen über geringere Koordinationsfähigkeiten.
Das Zentrum für interdisziplinäre Regionalforschung (ZEFIR) an der Universität Bochum und die Stadt Mülheim an der Ruhr haben im Auftrag der Bertelsmann Stiftung die Daten von knapp 5.000 Schuleingangsuntersuchungen aus den Jahren 2010 bis 2013 ausgewertet. Während 43,2 Prozent der armutsgefährdeten Kinder mangelhaft Deutsch sprechen, wurde dies nur 14,3 Prozent der nicht-armutsgefährdeten Kinder attestiert. Probleme in der Körperkoordination haben 24,5 Prozent der Kinder aus SGB-II-Familien (Übrige: 14,6). Ähnliches gilt für die Visuomotorik, der Koordination von Auge und Hand (25 zu 11 Prozent). 29,1 Prozent der armutsgefährdeten Kinder haben Defizite in ihrer selektiven Wahrnehmung (Übrige: 17,5), Probleme beim Zählen haben 28 Prozent (Übrige: 12,4). Adipös, also deutlich übergewichtig, sind 8,8 Prozent der Kinder, die von staatlicher Grundsicherung leben (Übrige: 3,7).
Diese Auffälligkeiten gehen einher mit einer geringeren Teilhabe der armutsgefährdeten Kinder an sozialen und kulturellen Angeboten. So erlernen lediglich 12 Prozent dieser Kinder ein Instrument (Übrige: 29). Vor Vollendung des dritten Lebensjahres gehen 31 Prozent der armutsgefährdeten Kinder in eine Kita (Übrige: 47,6). Und nur 46 Prozent der armutsgefährdeten Kinder sind vor Schuleintritt in einem Sportverein (Übrige: 77). Gerade die Mitgliedschaft in einem Sportverein wirkt sich aber nicht nur auf die Entwicklung der Körperkoordination positiv aus, sondern auf alle Entwicklungsmerkmale, so die Studie.
Auch ein früher Kita-Besuch kann negative Folgen von Kinderarmut verringern, allerdings ist das kein Automatismus. Positive Effekte für die Entwicklung der Kinder treten nur dann ein, wenn die Kita-Gruppen sozial gemischt sind. Weil aber Armut innerhalb einer Stadt höchst unterschiedlich verteilt ist, können Kitas in sozialen Brennpunkten genau diese Heterogenität oftmals nicht gewährleisten. In Mülheim etwa liegen in einigen Stadtvierteln die Armutsquoten über 50 Prozent. Deshalb empfehlen die Studienautoren, die Ressourcen nicht nach dem „Gießkannenprinzip" zu verteilen: „Kitas in sozialen Brennpunkten brauchen mehr Geld, mehr Personal und andere Förderangebote", sagte Brigitte Mohn, Vorstand der Bertelsmann Stiftung.
Die Bertelsmann Stiftung hat deshalb gemeinsam mit der Landesregierung Nordrhein-Westfalen in 18 Städten und Kreisen das Pilotprojekt „Kein Kind zurücklassen" gestartet. Gemeinsam mit Kommunalpolitik und Verwaltung sollen Präventionsketten entwickelt werden, um die Entwicklung armutsgefährdeter Kinder frühzeitig zu fördern. Dazu gehört, SGB-II-Familien gezielt anzusprechen und zu motivieren, ihrem Kind einen Kita-Besuch zu ermöglichen. Außerdem sollen etwa Brennpunkt-Kitas stärker mit sozialen Diensten sowie Sport- und Kulturvereinen im jeweiligen Stadtteil zusammenarbeiten. Ein wichtiges Ziel ist, kommunale Gelder neu zu verteilen und sich dabei stärker an den Bedarfen der Kitas und Stadtviertel zu orientieren.
Weitere Informationen: www.bertelsmann-stiftung.de und www.kein-kind-zuruecklassen.de
Quelle: Pressemitteilung der Bertelsmann Stiftung vom 13.3.2015
Armutsbericht 2014 des PARITÄTISCHEN: Die zerklüftete Republik
Der Armutsbericht des PARITÄTISCHEN ist in diesem Jahr etwas später erschienen – und hat auch bereits große Resonanz in den Medien erzielt. Gleichwohl tut diese Verzögerung der Brisanz der Erkenntnisse keinen Abbruch. Die Armut in Deutschland hat nicht nur ein neuerliches trauriges Rekordhoch erreicht, auch ist Deutschland dabei, regional regelrecht auseinander zu fallen. Zwischen dem Bodensee und Bremerhaven, zwischen dem Ruhrgebiet und dem Schwarzwald ist Deutschland, was seinen Wohlstand und seine Armut anbelangt, mittlerweile ein tief zerklüftetes Land.
Die wichtigsten Befunde im Überblick:
- Die Armut in Deutschland hat mit einer Armutsquote von 15,5 Prozent ein neues Rekordhoch erreicht und umfasst rund 12,5 Millionen Menschen.
Lesen Sie weiter auf der Seite des Landesfamilienrates hier.
Statistik BW: Heiraten? Ja, später!
Rund 48 400 Paare in Baden Württemberg gaben sich 2013 das »Jawort« – annähernd jede sechste Ehe wurde zwischen Deutschen und Ausländern geschlossen. 48 426 Paare haben im Jahr 2013 in Baden Württemberg geheiratet. Damit lag die Zahl der Eheschließungen auf einem ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren. Gegenüber dem Beginn der 1990er-Jahre sind die Heiratszahlen allerdings um etwa ein Fünftel zurückgegangen. Damals gaben sich noch jährlich etwa 60 000 Paare das »Jawort«.
Brautpaare sind immer älter. Im Jahr 2013 waren die Männer bei der ersten Eheschließung im Schnitt 33,2 Jahre und die Frauen 30,5 Jahre alt. Damit ist das Durchschnittsalter, in dem ledige Männer und Frauen vor den Standesbeamten treten, in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Noch Mitte der 1980er-Jahre lag das durchschnittliche Heiratsalter annähernd 6 Jahre niedriger. Dieser Trend hin zu einer späteren Heirat dürfte unter anderem auf die im Schnitt gestiegene Ausbildungsdauer zurückzuführen sein, aber auch darauf, dass immer mehr Partner – im Gegensatz zu früher – zunächst in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft leben. Allerdings gab es auch im Jahr 2013 Paare, die sehr jung geheiratet haben: Bei immerhin 31 Eheschließungen waren sowohl der Mann als auch die Frau jünger als 20 Jahre alt.
Ganzer Text der Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes vom 5.3.2015: hier
FaFo: Report Familien in Baden-Württemberg zum Thema „Väter"
Neue Ausgabe erschienen
http://www.familienfreundliche-kommune.de/FFKom/Aktuelles/detail.asp?20150304.2.xml
Bird, Katherine/Hübner, Wolfgang
Handbuch der Eltern- und Familienbildung mit Familien in benachteiligten Lebenslagen
978-3-8474-0102-5
Erscheinungsjahr: 10/2013
206 Seiten 19,90 €
Bei der Arbeit mit Familien in benachteiligten Lebenslagen begegnen Fachkräfte der Eltern- und Familienbildung manchem Stolperstein. Wie können Fachkräfte darauf reagieren und welche Lösungswege bieten sich an? Das Handbuch verbindet aktuelle Erkenntnisse der sozialwissenschaftlichen Forschung mit Aufgabenstellungen aus der Praxis. Ergebnis ist eine differenzierte Sicht auf die Eltern, die maßgeblich zur Entwicklung neuer Ansprachewege und Modelle der Zusammenarbeit beitragen kann.
Das Handbuch beruht auf einer von den AutorInnen im Auftrag des AWO Bundesverbands verfassten Expertise zu Familien in benachteiligten und von Armut bedrohten oder betroffenen Lebenslagen als Adressaten von Elternbildung und Elternarbeit.
Die AutorInnen: Dr. Katherine Bird, Soziologin, Berlin
Wolfgang Hübner M.A., Historiker und Kulturwissenschaftler, Berlin
gemeinsam als „Bird und Hübner GbR" in den Feldern Forschung, Evaluation und Beratung mit dem Schwerpunkt Eltern- und Familienbildung tätig.
Zielgruppe: Fachkräfte der Eltern- und Familienbildung
Keywords: Familienbildung, Elternbildung, soziale Benachteiligung
Fachbereiche: Eltern- und Familienbildung, Soziale Arbeit, Sozialwissenschaft
Rezensionen:
- Das Handbuch befasst sich mit der breiten Angebotspalette der Familienbildung sowohl aus der Sicht der Anbieter als auch aus der Sicht der angesprochenen Eltern. Die aktuellen Erkenntnisse der sozialwissenschaftlichen Forschung, insbesondere die Kategorisierung, bieten per se bereits eine Reflexionsgrundlage der eigenen Praxis. Wie eine solche Weiterentwicklung und Optimierung strukturiert angegangen werden kann, zeigen dann sehr anschaulich die Fortbildungsmodule. www.familien-mit-zukunft.de, 27.02.2014
- Eine fundierte Grundlegung für in der Eltern- und Familienbildung tätige Fachkräfte. www.ekz.bibliotheksservice 52/2013
- Das Handbuch bringt die wissenschaftlichen Debatten dazu zusammen und zeigt neue Wege des sozialen Handelns anhand des intergenerativen Arbeitens auf. [...] Dafür bedarf es entsprechender Strukturen und Rahmenbedingungen – und hierfür gibt dieses Handbuch eine Fülle von Hinweisen.
AOL - Bücherbrief 79/2014
Ernährung und Bewegung: neue Ausgabe „frühe Kindheit" erschienen
Zu dem Themenschwerpunkt „Ernährung und Bewegung" ist die neue Ausgabe der Zeitschrift „frühe Kindheit" erschienen. Das Heft enthält Beiträge u. a. von Mathilde Kersting und Annett Hilbig („Gesunde Ernährung von Anfang an – Ernährungskonzepte und ihre Umsetzung in der Praxis"), Utta Reich-Schottky („Aktuelle Herausforderungen in der Stillförderung"), Aleyd von Gartzen („Ernährung im ersten Lebensjahr – vom Baby-gesteuerten Stillen zur Baby-gesteuerten Beikosteinführung"), Kristin Manz („Körperliche und sportliche Aktivität im frühen Kindesalter: Ergebnisse der KiGGS Welle 1"), Susanne Przybilla und Ulrike Ungerer-Röhrich („Bewegte Kinderkrippe"), Norbert Fessler und Michaela Knoll („Körperbasiertes Achtsamkeits-Training: Ein Basis-Modul zur Förderung der Kindergesundheit") sowie ein Interview mit Rena te Zimmer, Professorin für Sportwissenschaft an der Universität Osnabrück und Direktorin des Niedersächsischen Instituts für Frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe) („Die Kultur des Körpers muss nicht in Konkurrenz zur Kultur des Geistes stehen").
Außerdem enthält das Heft folgende Praxisbeiträge: „Babyfreundlich" – Eine Initiative von WHO und UNICEF", „Gesund von Anfang an – Philosophie und Arbeit der Plattform Ernährung und Bewegung", „Netzwerk Gesund ins Leben: Gleiche Botschaften für ALLE", „Is(s)t Kita gut? 7 Fragen zur (Mittags-)Verpflegung in deutschen Kitas. 7 Antworten der Bertelsmann Stiftung: Status quo, Handlungsbedarfe und Empfehlungen", „Wir bringen Kinder in Schwung: Die Vision der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg".
Das Heft kann bei der Geschäftsstelle der Deutschen Liga für das Kind zum Preis von 6,- Euro (zzgl. Versandkosten) bestellt werden.
Deutsche Liga für das Kind, Charlottenstr. 65, 10117 Berlin
Tel.: 030 - 28 59 99 70, Fax: 030 - 28 59 99 71
E-Mail: post@liga-kind.de, www.fruehe-kindheit-online.de
Neuer Leitfaden: Symptome von Gewalt und Vernachlässigung schnell identifizieren
Mit dem Titel „Stoppt Gewalt gegen Kinder und Jugendliche" haben die Techniker Krankenkasse und das Ministerium für Arbeit und Soziales am 25. Februar 2015 in Magdeburg einen neuen Leitfaden zur Früherkennung von Vernachlässigung und Misshandlung vorgestellt. Die dritte Auflage des erstmals im Jahr 1999 erschienenen und jetzt komplett überarbeiteten Ratgebers wendet sich nicht nur an Ärztinnen und Ärzte, sondern zusätzlich jetzt auch an Zahnärztinnen und Zahnärzte.
Der in Zusammenarbeit mit der Allianz für Kinder des Landes Sachsen-Anhalt und mit Unterstützung des Ministeriums für Inneres und Sport, der Ärztekammer, der Kassenzahnärztlichen Vereinigung sowie des Gesundheitsamtes Magdeburg erstellte Leitfaden soll Medizinerinnen und Mediziner dabei unterstützen, Symptome von Gewalt und Vernachlässigung schnell zweifelsfrei zu identifizieren. Zugleich enthält die Broschüre rechtliche Hinweise und Tipps, was und vor allem mit welchen Kooperationspartnern zu tun ist, wenn es einen begründeten Verdacht der Kindesmisshandlung gibt.
Der Leitfaden wird mit einer Startauflage von zunächst 4.500 Exemplaren erscheinen. Er ist zugleich im Internet auf den Seiten der TK unter www.tk.de/lv-sachsenanhalt sowie auf der Startseite des Sozialministeriums unter www.ms.sachsen-anhalt.de zu finden.
Quelle Pressemitteilung des Ministeriums für Arbeit und Soziales vom 25.2.2015
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) erweitert mit Informationen zum Thema „Kinder unterstützen – psychische Gesundheit stärken" das Angebot zur Gesundheit und Entwicklung von Kindern auf www.kindergesundheit-info.de
Psychisches oder seelisches Wohlbefinden gehört zu den Grundpfeilern einer gesunden kindlichen Entwicklung. Gerät die Seele dauerhaft aus dem Gleichgewicht, werden bei Kindern und Jugendlichen psychische Auffälligkeiten diagnostiziert – Ängste, depressive Störungen, hyperkinetische Störungen wie beispielsweise ADHS. Die Auslöser und Ursachen hierfür können vielfältig sein und von biologischen Faktoren bis hin zu besonders belastenden und ungünstigen Lebensbedingungen reichen. Häufig sind es auch Unsicherheiten von Eltern und Bezugspersonen im Familien- und Erziehungsalltag, welche die Entwicklung von psychischen Störungen und Verhaltensauffälligkeiten begünstigen. Im Umkehrschluss können Eltern und andere Bezugspersonen vorbeugend einiges tun, damit ein Kind sich auch psychisch gesund entwickelt und seelisch wohlfühlt. Ein feinfühliges Eingehen auf die kindlichen Bedürfnisse g ehö rt ebenso dazu wie nachvollziehbare Grenzen und Regeln.
Auf www.kindergesundheit-info.de erfahren Eltern, wie sie Kinder in ihrer Entwicklung so begleiten und unterstützen können, dass sie die jeweils alterstypischen Entwicklungsaufgaben erfolgreich bewältigen, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen entwickeln und genügend Raum für die Entfaltung ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten für ein eigenständiges Leben haben. Es wird aber auch deutlich gemacht, dass nicht jedes „störende" Verhalten gleich eine Störung ist, denn Kinder sind ganz unterschiedlich in ihrer Entwicklung, in ihrem Temperament und in ihrer Art. Wenn ein Kind einmal einen „schlechten Tag" hat, muss das nicht gleich Anlass zur Sorge sein. Ergänzt werden die Informationen durch den „Wegweiser bei Problemen in der kindlichen Entwicklung und in der Familie" – denn bei ernsthaften Problemen und Konflikten ist es gut zu wissen, wohin man sich wenden kann.
Ausführliche Informationen hier.
Quelle: Pressemitteilung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) vom 10.3.2015
„Leipziger Lesekompass": Auszeichnung von 30 Kinder- und Jugendbüchern
Die Leipziger Buchmesse und die Stiftung Lesen haben am 12. März 30 besonders empfehlenswerte Kinder- und Jugendbuchtitel mit dem „Leipziger Lesekompass" ausgezeichnet und auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt. Die Siegertitel sind nach Auffassung der interdisziplinären Jury besonders geeignet, Freude am Lesen zu vermitteln und so Lesekompetenz zu fördern. Der „Leipziger Lesekompass" spricht bewusst auch Wenigleser an und umfasst Romane genauso wie Bilder-, Sach- und Hörbücher. Ein in diesem Jahr neuer Trend für die jüngste Zielgruppe sind Bilderbücher ohne oder mit nur sehr wenig Text, die sich auch hervorragend für Kinder mit begrenzten Sprachkenntnissen eignen. Ein Überblick über alle prämierten Titel ist unter www.leipziger-lesekompass.de verfügbar.
Eltern, Erzieher, Lehrkräfte, Bibliothekare und Buchhändler stellen sich häufig die Frage: Mit welchen Titeln können Kinder und Jugendliche für das Lesen begeistert werden – vor allem diejenigen, die (noch) nicht gerne lesen oder denen das Lesen schwerfällt? Aus den rund 8.000 jährlichen Neuerscheinungen auf dem Kinder- und Jugendbuchmarkt die passende Lektüre auszuwählen, fällt vielen schwer. Dieser Herausforderung nimmt sich der „Leipziger Lesekompass" an und prämiert jedes Jahr neue Titel, die sowohl unterschiedliche Lese-Niveaus als auch verschiedene Interessen berücksichtigen. Die Liste umfasst jeweils zehn empfehlenswerte Titel für die Altersgruppen 2 bis 6, 6 bis 10 und 10 bis 14 Jahre, ausgewählt von einer Jury aus Buchhandel, Bibliothek, Pädagogik, Medien sowie Jugendlichen.
(...) Neben den konkreten Titelempfehlungen des „Leipziger Lesekompass" erhalten Eltern, Erzieher, Lehrkräfte, Bibliothekare und Buchhändler weitere Unterstützung für die tägliche Leseförderung: Workshops bereits während der Leipziger Buchmesse vermitteln Tipps zum Einsatz der Titel in Kita, Schule, Bibliothek und zuhause.
Quelle: Pressemitteilung der Stiftung Lesen und der Leipziger Buchmesse vom 12.3.2015
Rezension - "Die überforderte Generation": Keine Zeit für Kinder
Eine Buchbesprechung des Werks von Prof. Hans Bertram "Die überforderte Generation", von Kostas Petropulos:
Eine "gehetzte Generation" hat sie die SPD genannt: die Altersgruppe der 30- bis 50-Jährigen. Innerhalb kürzester Zeit sollen sie Berufseinstieg, Partnerfindung und Familiengründung unter einen Hut bringen. Im Kampf gegen den demographischen Wandel – also gegen Kinderschwund, Arbeitskräftemangel und Vergreisung – glaubt die Politik, ein Patentrezept entdeckt zu haben: Mehr Mütter auf den Arbeitsmarkt und mehr Krippen und Ganztagsschulen für den Nachwuchs. Das sollte die Kinder- und Altersarmut sinken und die Geburtenrate steigen lassen.
Diese "modernisierte Familienpolitik" war vom Blick auf das angeblich fortschrittliche Ausland inspiriert - etwa Schweden. Der Berliner Familienforscher Hans Bertram sorgt nun in seinem neuen Buch „Die überforderte Generation" für faktengesättigte Ernüchterung. So zeige sich beim internationalen Vergleich: "dass der Ausbau der Kinderbetreuung nur einen sehr begrenzten Einfluss auf die geringen Geburtenzahlen und die Kinderlosigkeit haben kann, weil die zunehmende Kinderlosigkeit und die geringeren Geburtenzahlen völlig unabhängig vom staatlichen Ausbau in Finnland, dem privaten Ausbau in den USA oder den Niederlanden eine klare Folge der zunehmenden Integration der Frauen in das Erwerbsleben sind."
Lesen Sie weiter beim Landesfamilienrat hier.
Zeitungsartikel "Stuttgarter Repaircafe"
Aufmerksame Zeitungsleser sind in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder auf das Thema "Repaircafe" gestoßen: eine mehr oder weniger ehrenamtliche Werkstatt, in der alles Mögliche zu günstigen Preisen repariert werden kann. Auf der einen Seite stehen Rentner oder auch Studenten, die gerne helfen wollen, auf der anderen Seite Menschen, die nicht zur Wegwerfgesellschaft gehören möchten, aber selbst nicht die Fähigkeiten oder MÖglichkeiten haben, Reparaturen selbst durchzuführen. Wäre das nicht auch eine Idee für Ihre Familien-Bildungsstätte?
Lesen Sie den Artikel im Anhang (2 Teile).
Nominierte Projekte für Goldene Göre des Deutschen Kinderhilfswerkes stehen fest
Sechs Kinder- und Jugendprojekte aus ganz Deutschland dürfen sich seit dem 3. März Hoffnung auf die Goldene Göre machen. Eine Jury hat die Projekte aus Gustavsburg, Herrenberg, Lingen (Ems), Ludwigslust, Nürnberg und Potsdam für die Endrunde nominiert. Die Goldene Göre ist mit insgesamt 11.000 Euro der höchstdotierte Preis für Kinder- und Jugendbeteiligung in Deutschland. Mit der Goldenen Göre werden Projekte ausgezeichnet, bei denen Kinder und Jugendliche beispielhaft an der Gestaltung ihrer Lebenswelt mitwirken. Der Preis wird am 14. Juni 2015 im Europa-Park in Rust verliehen. Dazu werden die nominierten Projekte in den nächsten Wochen mit einem Kurzfilm porträtiert und zur Preisverleihung mit beteiligten Kindern und Jugendlichen in den Europa-Park eingeladen.
„Das war schon ein hartes Stück Arbeit, um aus den fast 100 Projekten sechs für die Endrunde zu nominieren, denn es hatten sich unglaublich viele tolle Projekte beworben. Zum Glück hatte die Jury mit Regina Halmich, Enie van de Meiklokjes, Ingo Dubinski und Björn Moschinski prominente Unterstützung. Mit der Goldenen Göre setzt sich das Deutsche Kinderhilfswerk im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention für eine stärkere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Fragen und Belangen ein. Oberstes Ziel ist es, die Kinder und Jugendlichen im Rahmen der Preisverleihung für ihr Engagement zu würdigen und ihre Projekte der Öffentlichkeit vorzustellen. Die Ehrung soll das Können von Kindern und Jugendlichen aufzeigen, sie für ihre Leistung auszeichnen und ihnen die Öffentlichkeit geben, die sie für ihr Engagement verdienen", betont Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführe r des De utschen Kinderhilfswerkes.
Die Gewinner des 1. Platzes erhalten ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro, der 2. Platz ist mit 3.000 Euro, der 3. Platz mit 1.000 Euro dotiert. Die Preisträger werden durch den Kinder- und Jugendbeirat des Deutschen Kinderhilfswerkes als Kinderjury ermittelt. Zusätzlich gibt es einen Leserpreis in Höhe von 1.000 Euro, der gemeinsam mit dem Medienhaus Family Media ausgelobt und vergeben wird. Im Rahmen der Goldenen Göre vergibt das Deutsche Kinderhilfswerk gemeinsam mit dem Europa-Park in diesem Jahr außerdem erstmalig die Europa-Göre, mit der ein Kinder- und Jugendprojekt ausgezeichnet wird, das sich für den europäischen Gedanken und die europäische Verständigung einsetzt.
Quelle: Pressemitteilung des Deutschen Kinderhilfswerks vom 3.3.2015
iaf zum Tag der Muttersprache: Mehrsprachigkeit – das unterschätzte Potential
Immer mehr Kinder kommunizieren in ihrem Alltag in mehreren Sprachen. Diese Kompetenzen werden im Bildungssystem jedoch selten gesehen und angemessen gefördert. Die Bedeutung von Sprachkenntnissen wird nur dann betont, wenn sie wie Englisch oder Französisch traditionell als Fremdsprachen bereits anerkannt sind. Die Sprachen der Zuwanderinnen und Zuwanderer wie beispielsweise Türkisch hat man dabei nicht im Blick. Und dies obwohl zahlreiche Studien belegen, dass eine Anerkennung und Förderung der Erstsprachen ganz klar auch den Zweitspracherwerb im Deutschen unterstützt.
„Das, was in unserem Bildungssystem diesbezüglich schief läuft, wird fälschlicherweise den Kindern und ihren zugewanderten Familien angekreidet. Würde die Förderung von Mehrsprachigkeit als Bildungsauftrag verstanden, könnte sich daraus ein großes Potential entwickeln, sowohl individuell als auch gesellschaftlich, wirtschaftlich und kulturell", so die Landesgeschäftsführerin NRW, Michaela Schmitt-Reiners. „Es ist unumstritten, dass das Aufwachsen und Leben in mehr als einer Sprache die Entwicklung geistiger und sprachlicher Fähigkeiten positiv unterstützt."
Zum Internationalen Tag der Muttersprache, 21. Februar 2015, erscheint eine neue Postkarten-Serie zu Mehrsprachigkeit des Verbandes binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V. Auf den Postkarten sind acht Sprachen in acht Schriften dargestellt, die den Ausdruck „Guck mal!" oder „Schauen Sie, bitte!" wiedergeben. Alle Sprachen sind lebendige Sprachen in unserem Land, die aber nicht wahrgenommen, geschweige denn geschätzt werden. Die Aktion hinter der Botschaft: Wer zuerst herausfindet, um welche Sprachen es sich handelt, und dies in einer E-Mail an nrw@verband-binationaler.de mitteilt, erhält einen Gutschein im Wert von 50 € für den Erwerb von Fachbüchern und Materialien zum Thema Mehrsprachigkeit.
Weitere Informationen und Postkarten unter www.mehrsprachigvorlesen.verband-binationaler.de
Quelle: Pressemitteilung des Verbandes binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V. vom 19.2.2015
Hebammen: Freie Wahl des Geburtsortes soll künftig massiv eingeschränkt sein
Die gesetzlichen Krankenkassen fordern in den aktuellen Verhandlungen mit den Hebammenverbänden Ausschlusskriterien für Hausgeburten und verweigern Frauen die Bezahlung der Hausgeburt, sobald diese vorliegen. Diese Ausschlusskriterien sind bisher nicht wissenschaftlich belegt. Zudem sollen Vorgespräche von Hebammen mit Schwangeren zur Geburt und der Wahl des Geburtsortes nicht ausreichend finanziert werden. Die Kassen fordern, beispielsweise auch die Überschreitung des errechneten Geburtstermins als Ausschlusskriterium für eine Hausgeburt zu definieren – davon ist allein schon die Hälfte aller Schwangeren betroffen. So wird faktisch ein Großteil der Hausgeburten künftig als private Leistung definiert. Das schränkt die freie Wahl des Geburtsortes für Frauen und ihr Selbstbestimmungsrecht massiv ein. Der Deutsche Hebammenverband hat deshalb am 20. Februar die Verhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband zu diesem Punkt unterbrochen. Er fordert von den Krankenkassen die Entscheidungsfreiheit von Frauen bei der Wahl des Geburtsortes als Vertragsgrundlage anzuerkennen und auch künftig zu erhalten. Frauen darf weder das Recht noch die Kompetenz zur Mitsprache abgesprochen werden.
Die Forderung nach einem mündigen Patienten, der informierte Entscheidungen selbst trifft, gilt damit bei der Wahl des Geburtsortes nicht mehr. Den Frauen wird von den Kassen unterstellt, nicht selbst die beste Wahl für sich und ihr Kind treffen zu können. Martina Klenk, Präsidentin des Deutschen Hebammenverbandes e.V. meint dazu: „Seit wann bestimmen Krankenkassen über Frauen und ihre Kinder? Das ist anmaßend. Die Kassen überschreiten ihre Kompetenzen."
Die Verträge zur Einführung eines Qualitätsmanagements können damit nicht abgeschlossen werden. Für die Hebammen bedeutet dies, dass sie vorerst auf eine dringend notwendige fünfprozentige Vergütungssteigerung verzichten müssen. (...)
Der Hebammenverband protestiert gegen dieses Vorgehen zusammen mit Frauen, Eltern und weiteren Unterstützern unter www.unsere-hebammen.de/meine-entscheidung unter dem Motto #MeineGeburtMeineEntscheidung.
Zum Hintergrund: Hebammen arbeiten in Geburtshäusern bereits seit Jahren mit Ausschlusskriterien. Diese gelten jedoch medizinisch nicht als evidenzbasiert. Der für Geburtshäuser gültige Vertrag bezieht deshalb den Willen der Frau in die Entscheidung, wo die Geburt des eigenen Kindes stattfinden soll, mit ein. Die gesetzlichen Krankenkassen sind gesetzlich dazu verpflichtet, die freie Wahl des Geburtsortes zu gewährleisten, indem sie alle Formen der Geburtshilfe vergüten. Dies soll nun aufgeweicht werden.
Quelle: Pressemitteilung des Deutschen Hebammenverbandes e.V. vom 20.2.2015
„Early Life Care": Interdisziplinäre Weiterbildung mit akademischem Abschluss
Im Herbst 2015 startet in Salzburg und Wien ein neuer Lehrgang, der sich an alle Berufsgruppen wendet, die mit Schwangerschaft, Geburt und dem ersten Lebensjahr eines Kindes zu tun haben.
In den letzten Jahren hat das Thema „Frühe Hilfen" starkes gesundheitspolitisches Interesse gewonnen. Die Zahl der Initiativen, die Eltern bzw. Familien in den Lebensphasen Schwangerschaft, Geburt und erstes Lebensjahr Unterstützung zur Alltagsbewältigung anbieten, hat sich vermehrt. Ein wesentlicher Fokus ist die vernetzte Vorgangsweise aller beteiligten Berufsgruppen, die gemeinsam daran arbeiten, die Umfeldbedingungen bestmöglich für die gedeihliche Entwicklung von Kindern auszurichten. Nur so können sich deren Potenziale für gelingendes Leben und konstruktive Lebensperspektiven optimal entwickeln. Damit diese Kooperation vermehrt umgesetzt werden kann, braucht es kooperatives Arbeiten und vernetztes Lernen aller am Beginn des Lebens tätigen Personen.
Early Life Care ist ein Bildungsangebot, um diese unterschiedlichen Professionen fachlich interdisziplinär weiter zu bilden und die multiprofessionelle Zusammenarbeit und Kommunikation zu fördern. Mit diesen Lehrgängen tragen wir bei zur (1) Verbesserung der Unterstützungsangebote im Hochrisikobereich, (2) Verbesserung der Primärprävention, der bedarfsorientierten Begleitung von Schwangeren, Eltern und Familien, um hier eine Lücke im Bereich der prä- und perinatalen Gesundheitsversorgung zu füllen, (3) Entwicklung von Perspektiven, die zu einer Verankerung von kooperativen, interdisziplinären Stützungssystemen führen und damit eine Verbesserung der Early Life Care Versorgung ermöglichen, (4) Entwicklung und Vernetzung eines abgestuften lokalen, regionalen und überregionalen Systems von mobilen Einrichtungen und überregionaler Kompetenzzentren mit multiprofessionellen Teams.
Early Life Care ist ein Angebot zur wissenschaftlichen Weiterbildung, zum Wissenstransfer zwischen den beteiligten Disziplinen und zum Austausch zwischen den Professionen.
Informationen unter www.earlylifecare.at
Quelle: Pressestatement von Michaela Luckmann, Projektleiterin des Universitätslehrgangs Early Life Care, St. Virgil Salzburg, vom 24.2.2015
Start wissenschaftlicher Untersuchung von Sprachfördermaßnahmen in Kitas und Schulen
In 120 Kitas und Schulen in zehn Bundesländern hat die Untersuchung von sprachfördernden Maßnahmen im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Bildung durch Sprache und Schrift" (BiSS) begonnen.
Sprachförderung wird in Deutschland in allen Kitas und Schulen mit verschiedenen Instrumenten und Methoden umgesetzt. Über die Bedingungen der Wirksamkeit solcher Maßnahmen ist bisher wenig bekannt. Mehrere wissenschaftliche Projektgruppen wurden nun mit der Untersuchung der vor Ort angewandten Sprachfördermaßnahmen beauftragt. Ihre Evaluationsprojekte werden vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit insgesamt ca. 2,5 Millionen Euro finanziert. Sie laufen bis Ende 2017 und beinhalten zunächst eine Bestandsaufnahme der Sprachfördermaßnahmen in den Kitas, in Grundschulen und in weiterführenden Schulen. Anschließend erarbeiten die Wissenschaftler gemeinsam mit den Einrichtungen Vorschläge für einen wirkungsvolleren Einsatz der Maßnahmen.
Durch alltagsintegrierte sprachliche Bildung in der Kita werden Kinder in ihrer natürlichen Sprachentwicklung umfassend und systematisch gefördert. Wie diese alltagsintegrierte Sprachbildung in der Praxis angewandt wird, welche Rahmenbedingungen die Erzieherinnen und Erzieher brauchen und wie sie bei ihrer Arbeit bestmöglich unterstützt werden können, untersucht die Projektgruppe des Staatsinstituts für Frühpädagogik in München. Sie begleitet Erzieherinnen und Erzieher in 34 Kitas in Baden-Württemberg, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland.
Schülerinnen und Schüler lernen die deutsche Sprache nicht nur im Deutschunterricht, sondern auch im Fachunterricht und bei außerunterrichtlichen Aktivitäten. 23 Grundschulen aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und aus dem Saarland haben hier ihren Schwerpunkt. Sie wollen die bildungssprachlichen Kompetenzen insbesondere im Mathematik- und im Sachunterricht sowie im Nachmittagsangebot fördern. Die Zielgruppe der Sprachförderung sind dabei sowohl Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache als auch Kinder deutscher Herkunftssprache mit geringen Kompetenzen in der Bildungssprache Deutsch. Die Projektgruppen der Universität Potsdam, der Universität Wuppertal und der Technischen Universität Dortmund untersuchen die Verfahren, mit deren Hilfe der Sprachförderbedarf festgestellt wird, in Hinblick auf ihre Qualität und ihre Aussagekraft. Zudem werden die Fördermaßnahmen selbst ausgewertet. Und schließlich wird auch die Weiterbildung der Lehrkräfte für die Sprachförderung in den Blick genommen. Die Schulen erhalten fortlaufend Rückmeldungen über die Zwischenergebnisse. Am Ende der Projektlaufzeit sollen verbesserte Maßnahmen und Materialien für die Sprachförderung zur Verfügung stehen.
Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger sind Kinder und Jugendliche, die im schulpflichtigen Alter nach Deutschland einwandern und meist über keine oder nur geringe Deutschkenntnisse verfügen. Bislang fehlt in Deutschland ein übergreifendes Konzept für die Sprachförderpraxis mit neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern.
Das Evaluationsprojekt für die Förderung dieser Kinder und Jugendlichen findet an 63 weiterführenden Schulen in Berlin, Bayern, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen statt. Neben einer Bestandsaufnahme der bestehenden Sprachförderung wird auch die Unterrichtsqualität untersucht. Ziel des Projekts ist die Evaluierung bestehender Sprachfördermaßnahmen und deren Umsetzung. Dies ist eine Voraussetzung für die Entwicklung eines praxistauglichen Konzepts für die schulische Integration von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern in der Sekundarstufe I. Das Proj ekt wird von dem Forschungsverbund EVA-Sek der Friedrich-Schiller-Universität Jena, der Universität Bielefeld und der Europa-Universität Flensburg durchgeführt.
„Bildung durch Sprache und Schrift" (BiSS) ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) sowie der Kultusministerkonferenz (KMK) und der Konferenz der Jugend- und Familienminister (JFMK) der Länder zur Verbesserung der Sprachförderung, Sprachdiagnostik und Leseförderung. Das Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache der Universität zu Köln, das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) in Frankfurt am Main und die Humboldt-Universität zu Berlin in Kooperation mit dem Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) übernehmen als Trägerkonsortium die wissenschaftliche Ausgestaltung und Gesamtkoordination des Programms.
Ausführliche Informationen zum Programm finden Sie unter www.biss-sprachbildung.de
Quelle: Pressemitteilung des Projekts „Bildung durch Sprache und Schrift" vom 5.3.2015
Märchenerzählerin: Nicole Schneider
Frau Schneider beschreibt ihre Tätigkeit folgendermaßen:
"Heute bin ich nun über zehn Jahre als Märchenerzählerin unterwegs. Mit märchenhaften Ritualen, musikalischen Klängen und vielen zauberhaften Kleinigkeiten, gestalte ich die Märchenstunde für Kinder und mittlerweile auch für Erwachsene so, dass Ihnen das Erlebte noch lange in schöner Erinnerung bleibt. Das spezielle an der Märchenzeit ist, dass die Märchen von mir auswendig, frei und lebendig erzählt werden. Ich lese keine Märchen und Geschichten vor. Ich erzähle frei und genau das ist das Geheimnis. Ich beschäftige mich ausschliesslich nur mit Volksmärchen aus aller Welt. Und das ist auch gut so, denn diese Märchen gehen immer gut aus. Meine Website verrät Ihnen mehr über mich www.maerchenfueralle.de "
Vorschläge für die Platzierung von Märchen:
- Märchenzeit für Kinder mit anschließendem kreativen Gestalten
- Märchen für Erwachsene mit musikalischer Begleitung
- Elternabend oder Informationsveranstaltungen zum Thema Märchen und Heilung und warum Märchen Menschen stärken.
- Welche Märchen für mein Kind
- Kreatives Gestalten mit Märchenwolle ..Feen und Engel (für Erwachsene)
26.03.2015, 9.30-12.30 Uhr: LEF-Fortbildung 1.2 Arbeitsschutz konkret, LEF-Geschäftsstelle
26.03.2015, 14-17 Uhr: LEF-Leitungskonferenz, LEF-Geschäftsstelle
21.04.2015, 9-12.30 Uhr: LEF-Vorstand
23.04.2015, 9-12 Uhr: AG Gesundheit, LEF-Geschäftsstelle, Raum 200
28.04.2015, 9.30-12 Uhr: AG DEKT
29.-30.4.2015: Klausur der Verwaltungsmitarbeiter/innen in Birkach. Anmeldeschluss: 28.2.2015
30.04.2015, 10.30-12 Uhr: AG LOC, Videokonferenz
04.05.2015, 14-17 Uhr: AG DEKT
18.05.2015, 13-16.30 Uhr: LEF-Fortbildung 3.2 HIIT. Bitte noch anmelden!
03.-07.06.2015: LEF auf dem Kirchentag in Stuttgart, Markt der Möglichkeiten. Es werden noch Standmitarbeiter/innen gesucht!!!!
Redaktion: Kerstin Schmider
|
|